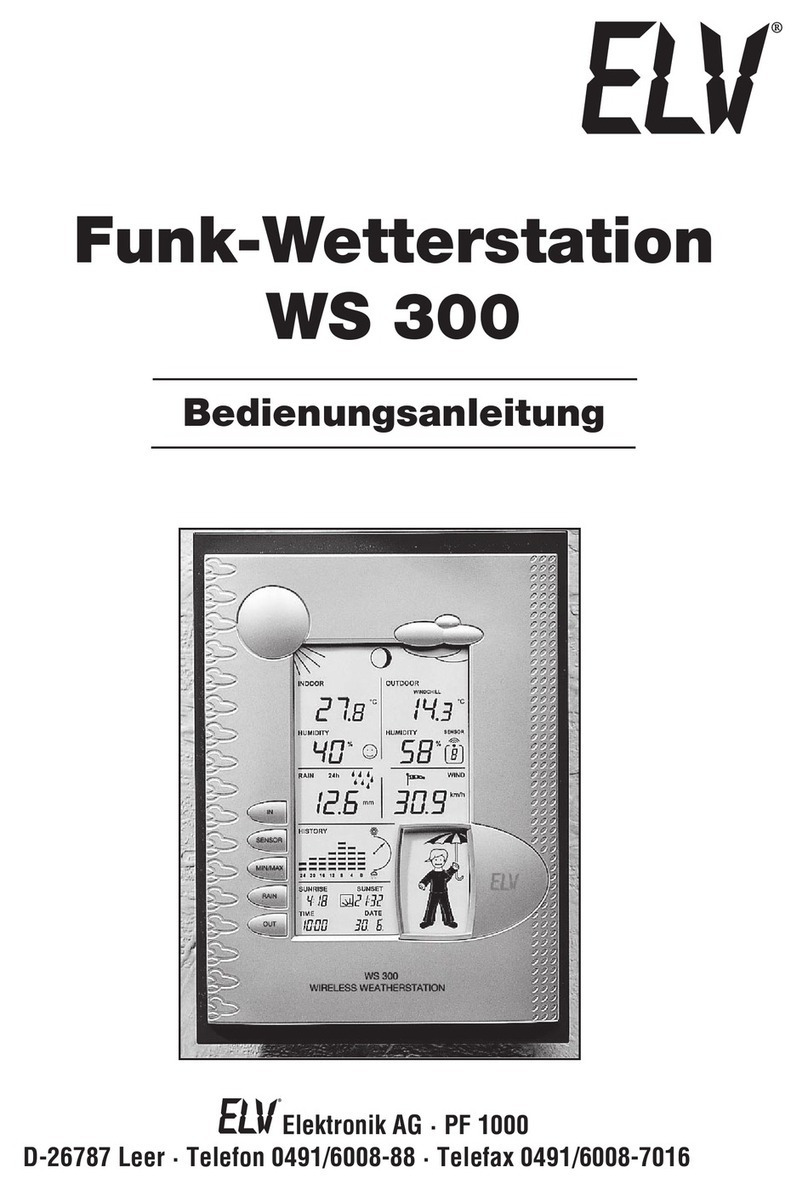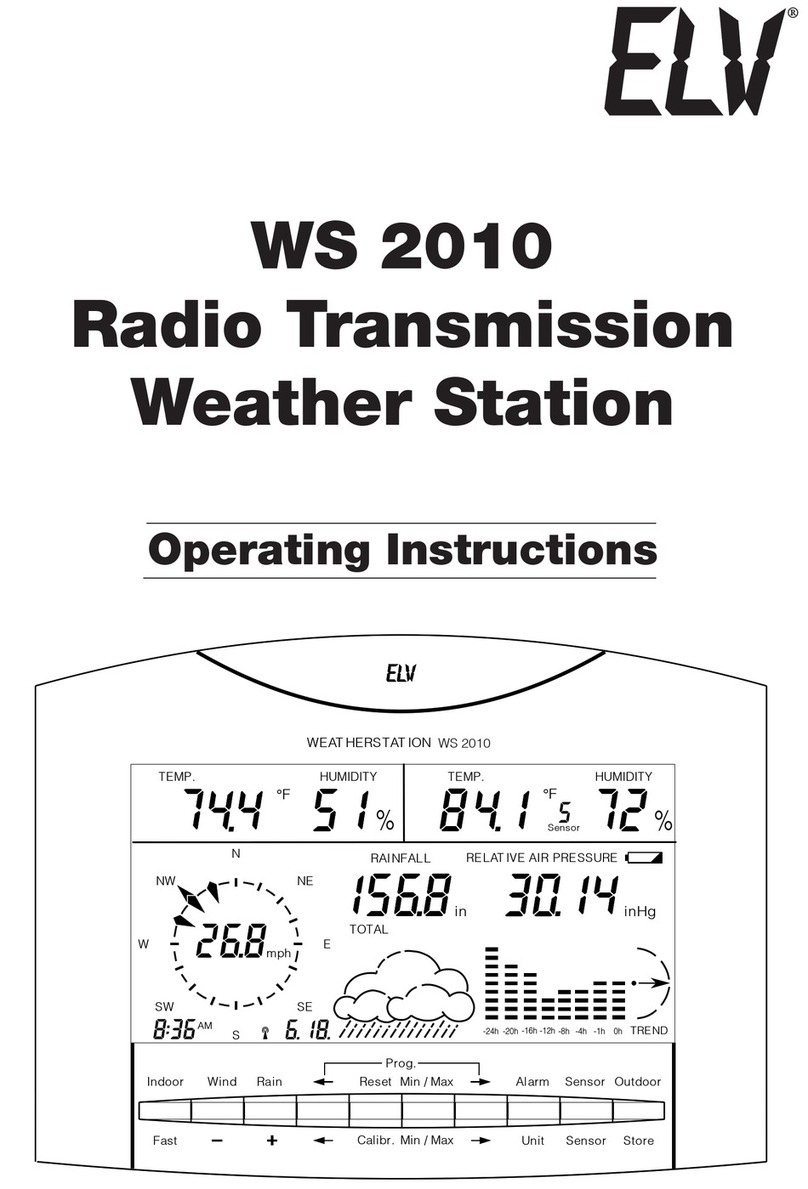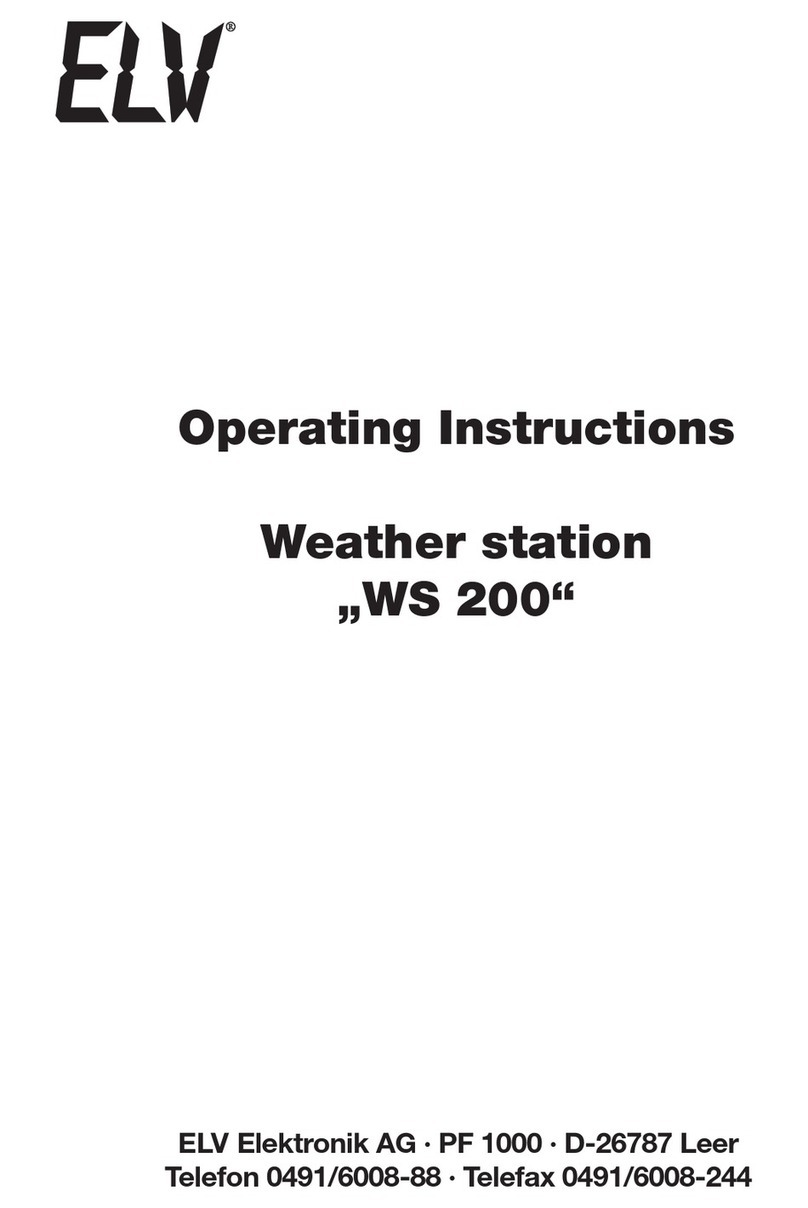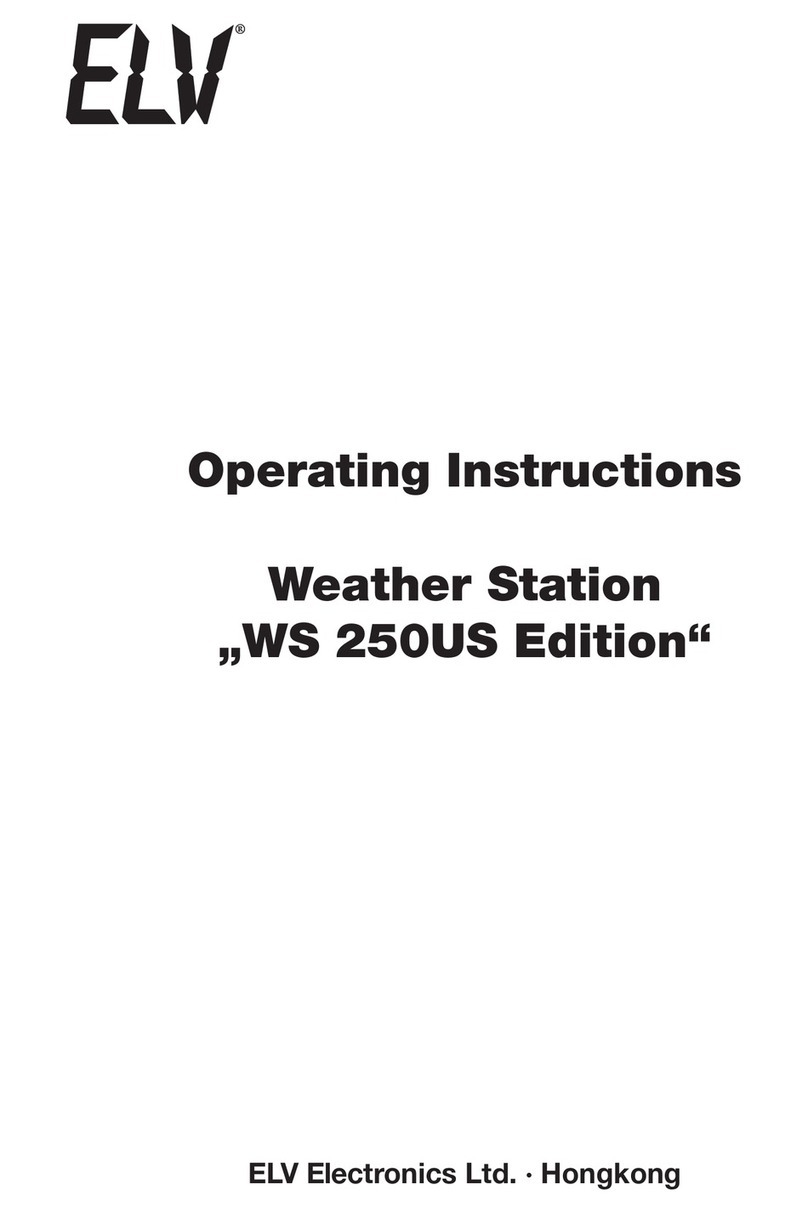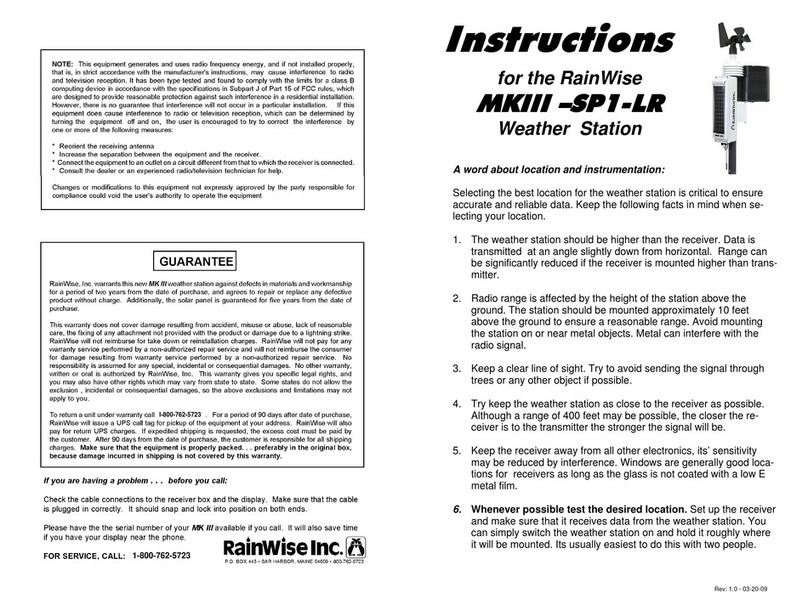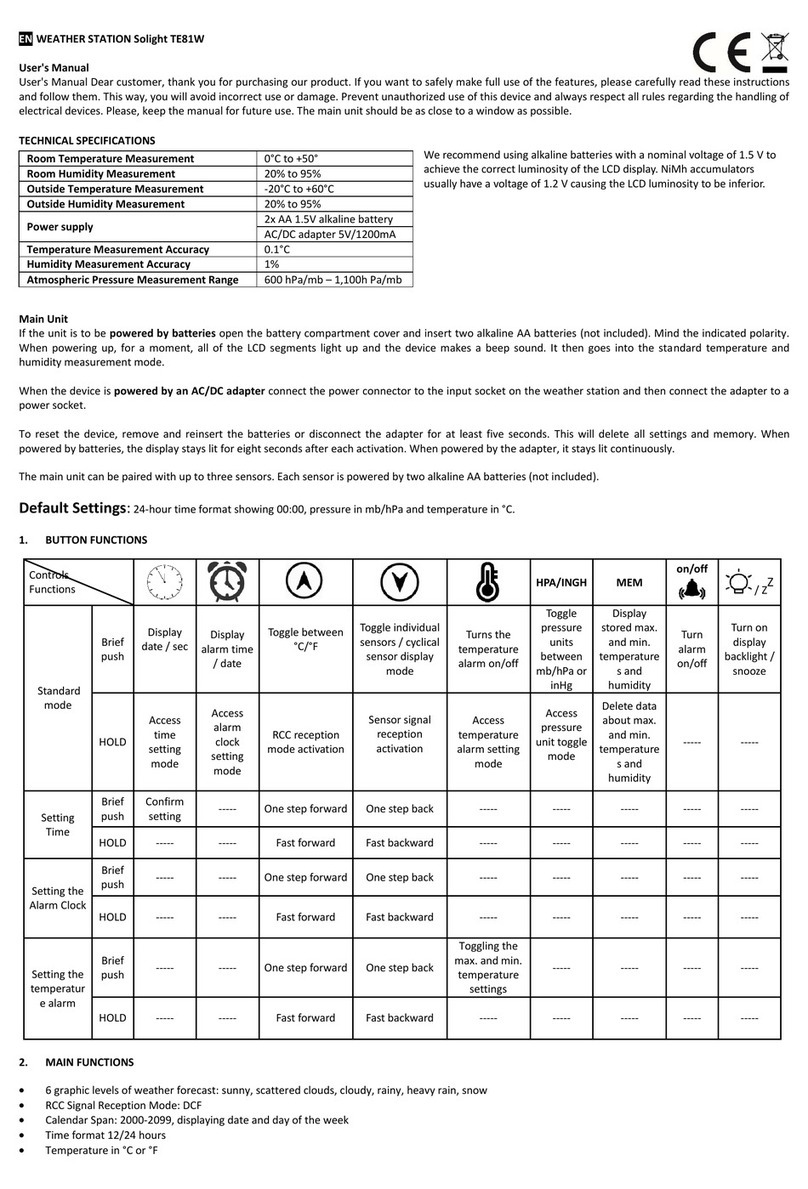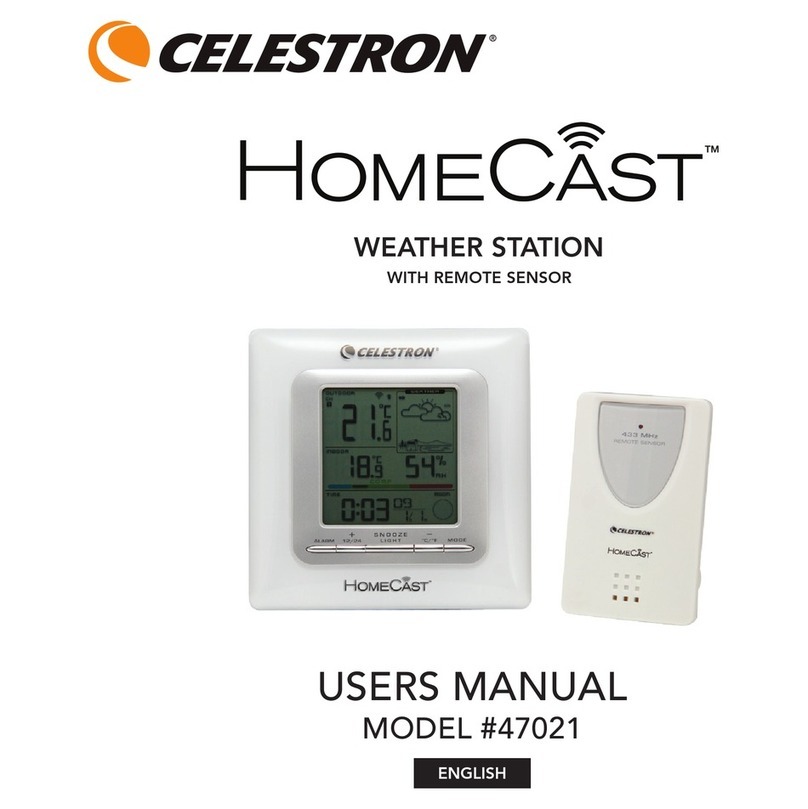elv WS 3001 User manual

1
WS 3001
Touch-Screen-
Funk-Wetterstation
Bedienungsanleitung Seite 3
Touch Screen Radio
Weather Station
Operating Instructions Page 47
Radiostation météo
à écran tactile
Mode d’emploi Page 91
USA
D
F

2
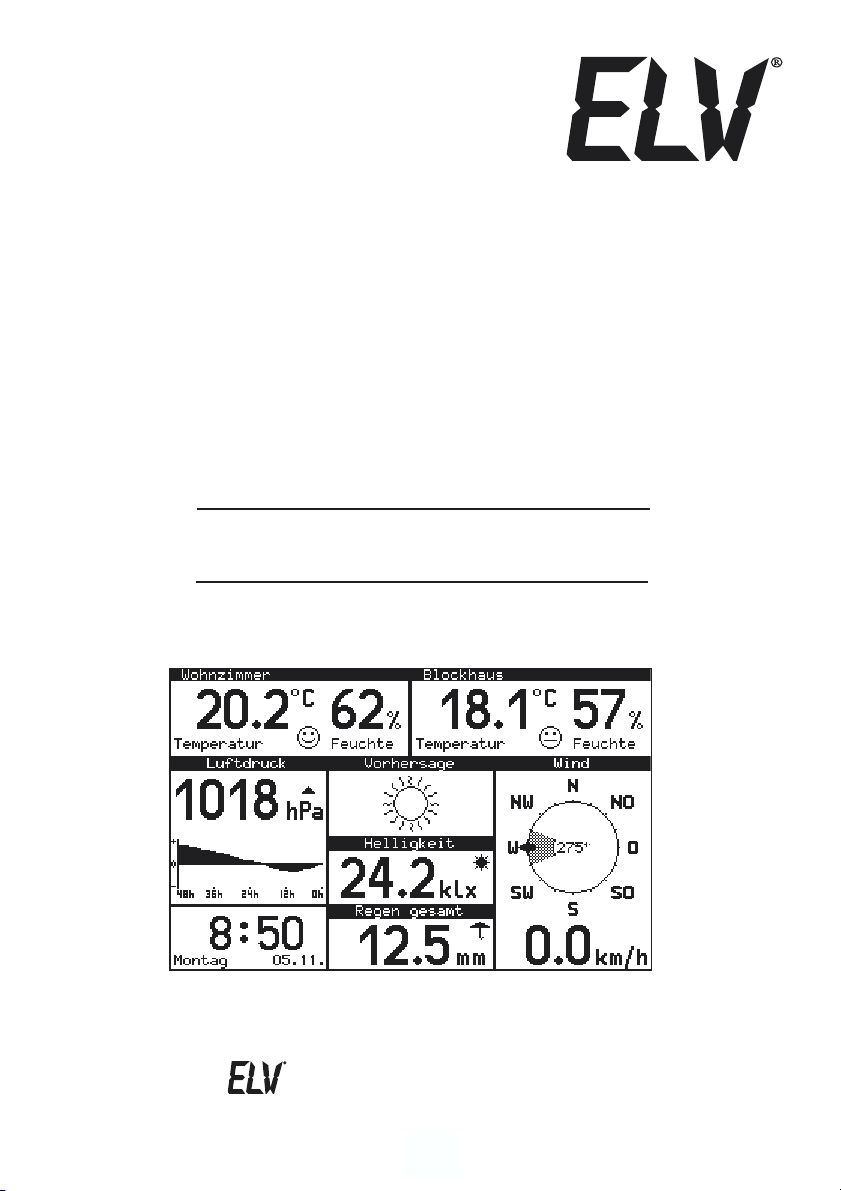
3
Touch-Screen-
Funk-Wetterstation
WS 3001
Bedienungsanleitung
Elektronik AG · PF 1000
D-26787 Leer · Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/6008-244

4
2. Ausgabe Deutsch
Juli 2002
Dokumentation
© 2002 ELV Electronics Limited
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch
nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer,
mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.
Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler auf-
weist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der
nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen
übernehmen wir keine Haftung.
Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.
Printed in Hong Kong
46114, 46115 V1.1 2002

5
Inhalt
1. Allgemeines und Funktion ..................................................................................................... 6
Übersicht über die Anzeigenfelder der Hauptanzeige ............................................................. 8
2. Vorbereitung zum Betrieb ................................................................................................... 10
2.1. Einsetzen der Magnete in die Außensensoren ...................................................................... 10
2.2. Vorbereitung des Basisgerätes und des Empfangsgerätes ................................................... 10
2.3. Beschreibung, Montage und Inbetriebnahme der Sensoren .................................................. 11
2.3.1 Innensensor S 2000 ID ........................................................................................................... 11
2.3.2 Windsensor S 2000 W ........................................................................................................... 11
2.3.3 Regenmengensensor S 2000 R ............................................................................................ 12
2.3.4 Helligkeitssensor S 2500 H .................................................................................................... 13
2.3.5 Adressierung der Sensoren S 2000 I/A, S 2001 IA, AS/ASH 2000 ....................................... 13
2.3.6 Temperatur-/Feuchtesensor S 2000 I ....................................................................................14
2.3.7 Temperatursensor S 2001 IA .................................................................................................14
2.3.8 Temperatur-/Feuchtesensor S 2000 A ................................................................................... 14
2.3.9 Temperatur-/Feuchte-Außensensor ASH 2000...................................................................... 15
2.3.10 Temperatur-Außensensor AS 2000 ........................................................................................ 15
2.3.11 Hinweis für die Lagerung der solarzellenversorgten Außensensoren .................................... 15
3. Bedienung ............................................................................................................................. 16
3.1. Grundeinstellungen ................................................................................................................ 16
3.1.1 Sensornamenverwaltung ....................................................................................................... 18
3.1.2 Uhrzeit einstellen/ändern, DCF-Empfang aktivieren/deaktivieren ......................................... 19
3.1.3 Systemeinstellungen .............................................................................................................. 20
3.1.4 Beleuchtung einstellen ........................................................................................................... 21
3.2. Bedienung der Messarten, Statistik- und Speicherfunktionen ..............................................23
3.2.1 Temperatur/Luftfeuchte ......................................................................................................... 23
3.2.2 Luftdruck ................................................................................................................................ 24
3.2.3 Regenmenge .......................................................................................................................... 25
3.2.4 Helligkeit und Sonnenscheindauer ........................................................................................ 26
3.2.5 Wind ....................................................................................................................................... 27
3.2.6 Verlaufsanzeige ...................................................................................................................... 28
3.2.7 Wettervorhersage ................................................................................................................... 29
4. Sondereinstellungen (Sensorverwaltung) .......................................................................... 30
Einstellung der Sensoradresse und der Sensorversion ......................................................... 30
Basisadresse für Sensoren mit fester Zuordnung ändern ..................................................... 31
Kalibrierung ............................................................................................................................ 31
Einstellung des Höhenabgleichs für den barometrischen Luftdruck ..................................... 31
Abgleich des Regenmengen-Messwertaufnehmers .............................................................. 32
Einstellung der Hauptrichtung der Windrose ......................................................................... 32
Einstellung des Schwellwertes für den Sonnenschein ..........................................................33
5. Fernbedienung ..................................................................................................................... 34
6. Batteriewechsel ................................................................................................................... 40
7. Hinweise zur Störungsbeseitigung .................................................................................... 40
8. Reichweite ............................................................................................................................ 42
9. Repeater zur Reichweitenerhöhung .................................................................................. 42
10. Wartungs- und Pflegehinweise ........................................................................................... 42
11. Technische Daten ................................................................................................................ 43
12. Begriffserklärungen ............................................................................................................. 44

6
1. Allgemeines und Funktion
Die Touch-Screen-Funk-Wetterstation WS 3001 stellt ein hochwertiges, äußerst
komfortables Universal-Wettermesssystem dar, das die Daten von bis zu 9 exter-
nen Funk-Temperatur- und Feuchtesensoren, einem Funk-Windsensor, einem Funk-
Helligkeitssensor und einem Funk-Regenmengensensor aufnehmen, verarbeiten
und anzeigen kann.
Herausragend ist das Bedienkonzept der Wetterstation. Diese verfügt über keiner-
lei Bedienelemente mehr, sie wird allein über einen berührungsempfindlichen, groß-
flächigen Bildschirm (Touch-Screen) und übersichtliche Menüstrukturen bedient.
Die umfangreichen, grafisch aufbereiteten und so auf einen Blick erfassbaren sta-
tistischen Wetterdaten erlauben die Analyse einzelner Wetterverläufe für bis zu
72 Stunden. Zusätzlich sind alle wichtigen Funktionen mit einer Funk-Fernbedie-
nung bedienbar.
Die Displaysprache ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,
Holländisch und Spanisch wählbar.
Das große Display ist ständig oder zeitgesteuert beleuchtbar, sodass es unter na-
hezu allen Lichtverhältnissen gut ablesbar bleibt.
Die Messmöglichkeiten der WS 3001 auf einen Blick:
- Bis zu 9 unterschiedliche, kombinierte Feuchte-/Temperaturmessstellen (1 x In-
nen + 8 weitere), davon werden zwei auf dem Display bei freier Zuordnung gleich-
zeitig dargestellt.
- Berechnung und Anzeige der Windchill-Äquivalent-Temperatur (siehe Begriffser-
klärungen) für alle Sensoren.
- Taupunkte, diese werden für jeden der neun Temperatur-/Feuchtemessstellen ge-
trennt berechnet.
- Temperaturanalyse für jede Messstelle mit grafischer Aufbereitung und Anzeige
für die letzten 72 Stunden, bei Sensoren mit Feuchtefühler gilt dies auch für die
Luftfeuchtigkeit.
- Anzeige der Temperatur wahlweise in ˚C oder ˚F.
- Luftdruck, wahlweise in hPa, mmHg oder inHg und Luftdruck-Tendenzanzeige.
- Grafische Anzeige der Luftdruckveränderungen der letzten 72 Stunden.
- Symbolanzeige für Wettervorhersage (sonnig, heiter, stark bewölkt, regnerisch),
wahlweise animierte Wettervorhersage-Anzeige.
- Komfortzonenindikator-Anzeige für jede Feuchte-/Temperatur-Messstelle.
- Windgeschwindigkeit, wahlweise in km/h, m/s, mph, Knoten oder Beaufort.
- Windrichtung in Form einer Windrose mit Anzeige der Windrichtungsschwan-
kungen.
- Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsanalyse mit grafischer Anzeige für die
letzten 72 Stunden.
- Anzeige der Uhrzeit im 12-h- oder 24-h-Modus.
- Speicherung der Minimal- und Maximal-Messwerte für sämtliche Sensoren mit
zugehöriger Zeit- und Datumsangabe (bei der Windgeschwindigkeit wird zusätz-
lich die zugehörige Windrichtung mit angezeigt, bei Temperaturen bzw. Luft-

7
feuchten der zugehörige Wert von Luftfeuchte bzw. Temperatur).
- Erfassung der Regenmenge mit < 0,5 mm Auflösung (gesamt, letzte Stunde, ak-
tuelle Stunde, letzter Tag, aktueller Tag, Min-Max-Werte mit Zeitpunkt und Da-
tum). Statistischer Verlauf der Regenmenge in den letzten 72 Stunden mit grafi-
scher Aufbereitung und Anzeige.
- Anzeige der Regenmenge wahlweise in l/m2, mm oder inch.
- Anzeige der Helligkeit bzw. Sonnenscheindauer: Helligkeit aktuell, Sonnenschein-
dauer letzter Tag, aktueller Tag, gesamt. Min-Max-Werte mit Zeitpunkt und Da-
tum. Statistischer Verlauf der Helligkeit in den letzten 72 Stunden mit grafischer
Aufbereitung und Anzeige. Helligkeitsanzeige in lux, Sonnenscheindauer in Pro-
zent oder h:min. Symbolanzeige für aktuellen Sonnenschein. Schwelle für
Sonnenscheinerkennung einstellbar.
- Integrierte DCF-Funkuhr für die Synchronisierung der Systemzeit der Wetter-
station mit dem Zeitsender Mainflingen zur exakten zeitlichen Zuordnung der
Messwerte.
- Besonders einfache, sog. kontextsensitive Bedienung über sehr unkomplizierte
Menüstrukturen.
- Ein Quittungston für die Bedienung ist wahlweise ein- und ausschaltbar.
- Je nach Ausführung als Tischgerät aufstellbar oder als Wandgerät aufhängbar.
- Datenerhalt aller gespeicherten Daten bei Stromausfall bis 24 h.
Alle wichtigen Wetterinformationen erscheinen gleichzeitig auf dem LC-Display,
sodass zur Erfassung der Wetterlage keine Bedienung des Gerätes erforderlich ist.
Mehrere Basisgeräte können gleichzeitig betrieben werden und so die Daten der
Sensoren an mehreren Stellen gleichzeitig zur Anzeige bringen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und komplett vor der ers-
ten Inbetriebnahme, um Funktionsstörungen und Fehlbedienungen zu vermei-
den.
Beachten Sie insbesondere die Montage- und Kalibrierhinweise zu den
Messwertaufnehmern.
Das Innen-/Außen-Sensorsystem der WS 3001 arbeitet ausschließlich mit Funk-
Datenübertragung. Sie können so die Sensoren bis zu 100 m (abhängig von den
örtlichen Verhältnissen, siehe Abschnitt „Reichweite”) von der Basisstation ent-
fernt aufstellen bzw. montieren. Größere Entfernungen sind mit einem Repeater
realisierbar (s. Abschnitt 9).
Einige Außensensoren beziehen ihre Betriebsspannung aus integrierten Solarzel-
len. Beachten Sie daher sehr sorgfältig die Aufstell- und Montagehinweise zu die-
sen Komponenten, um eine ordnungsgemäße Funktion des Gesamtsystems zu
gewährleisten.
Beachten Sie, dass zum Betrieb der Wetterstation mindestens ein Sensor
S 2000 ID erforderlich ist, da das Basisgerät keine eigenen Sensoren enthält.

8
Übersicht über die Anzeigenfelder der Hauptanzeige
ohne Helligkeitssensor
12
3
4
5
6
8
910 11
13
14
15
7
16
17
124
3
DCF
12
mit Helligkeitssensor
18 19

9
Bedeutung der Anzeigen:
1. Aktuelle Temperatur Innen-/Außensensor
2. Aktuelle Luftfeuchte Innen-/Außensensor
3. Tendenzanzeige für die Temperatur am Ort des jeweiligen Sensors
4. Komfortzonenindikator für die Anzeige angenehmes/unangenehmes Klima
5. Tendenzanzeige Luftdruck*:
großer Pfeil nach oben = stark steigend
kleiner Pfeil nach oben = leicht steigend
waagerechter Strich = konstant
kleiner Pfeil nach unten = leicht fallend
großer Pfeil nach unten = stark fallend
6. Anzeige des aktuellen Luftdrucks
7. Luftdruckhistorie über 48 Stunden, bezogen auf den aktuellen Wert
8. Uhrzeitanzeige
9. Datums- und Wochentagsanzeige
10. Anzeige für die Synchronisation mit DCF-Funkzeitsender
11. Anzeige der Regenmenge
12. Anzeige für aktuellen Regen (Regen in den letzten 15 min)
13. Anzeige Wettervorhersage (sonnig, heiter, bewölkt, regnerisch)
14. Numerische Anzeige der aktuellen Windrichtung
15. Schwankungsbereichsanzeige bei wechselnden Winden
16. Anzeige der aktuellen Windrichtung
17. Anzeige der Windgeschwindigkeit
18. Helligkeits-/Sonnenscheindaueranzeige
19. Anzeige für aktuellen Sonnenschein gemäß festgelegtem Schwellwert
Die Zuordnung der Temperatur- und Luftfeuchte-Sensoren zu den beiden oberen An-
zeigenfeldern erfolgt über die Unter-Menüs (siehe weitere Anleitung).
Die Zuordnung der jeweiligen Maßeinheiten erfolgt über die Unter-Menüs (siehe weitere
Anleitung).
Wird ein Sensor mehr als 3 h nicht empfangen, so erfolgt die Anzeige „- - -”.
* siehe auch Begriffserklärungen

10
2. Vorbereitung zum Betrieb
Die Außensensoren zur Windmessung, zur Erfassung der Regenmenge, zur
Helligkeitserfassung und zur Außentemperatur-/Feuchtemessung sind zur Strom-
versorgung mit einer Solarzelle und einem Lithium-Stützakku für Dunkelphasen
und Schlechtwetterperioden ausgestattet.
Zum Schutz des Akkus vor Tiefentladung während einer langen Lagerphase ohne
Lichteinfall auf die Solarzelle (z. B. in der Verpackung), wird die Spannungs-
versorgung vor der ersten Inbetriebnahme durch einen von außen einzusetzenden,
kleinen Magneten aktiviert. Der zum jeweiligen Sensor gehörige Magnet sollte da-
her erst kurz vor der Außenmontage der Sensoren eingesetzt werden.
Nach der Aktivierung der Sensoren (Einsetzen der Magnete bzw. bei den batterie-
versorgten Sensoren der Batterien) senden diese ca. 10 Minuten lang im Testmodus.
Das heißt, statt im normalen 3-Minutenraster senden sie für diese Zeit im
4-Sekundenraster. Dies dient dazu, einen optimalen Empfang sicherzustellen, in-
dem an der Basisstation der Empfang kontrolliert werden kann (siehe dazu Ab-
schnitt 3.1.3 Systemeinstellungen). Der jeweils letzte Empfang eines Sensors wird
hier protokolliert. Ändert sich die Empfangszeit nicht oder nur selten, so ist der
Empfang gestört und sollte durch eine andere Positionierung des Sensors verbes-
sert werden. Die Außen-Temperatur- und Feuchtesensoren sind entsprechend Ab-
schnitt 2.3.5 zu adressieren.
2.1. Einsetzen der Magneten in die Außensensoren
Beim Außensensor S 2000 A und beim Helligkeitssensor S 2500 H wird der Magnet
zum Aktivieren des Systems in eine dafür vorgesehene Öffnung an der Gehäuse-
rückseite gedrückt.
Die Aktivierung des Windsensors erfolgt ebenfalls durch Einsetzen eines kleinen
Magneten in die dafür vorgesehene Öffung. Die Magnetaufnahme befindet sich
oberhalb der Halterohrbefestigung (gegenüber der Solarzelle).
Zum Einsetzen des Magneten beim Regenmengensensor S 2000 R ist zunächst
das Oberteil durch Drücken und Rechtsdrehen gegenüber dem Unterteil abzuneh-
men. Am Gehäusedeckel des im Trichter eingebauten Elektronikgehäuses befindet
sich eine Rastaufnahme für den kleinen Rundmagneten. Nach dem polrichtigen
Eindrücken des Magneten (rote Kennzeichnung im Gehäuse) in die Aufnahme nimmt
der Regenmengensensor den Sendebetrieb auf.
2.2. Vorbereitung des Basisgerätes und des Empfangsgerätes
Die Vorbereitung des Basisgerätes besteht lediglich aus dem Anschluss des abge-
setzten Empfängers, des Basisgerätes und des Netzgerätes an die entsprechen-
den Buchsen des Spannungsverteilers (Netzgerät: Rundsteckerbuchse, Empfän-
ger: Western-Modular-Buchse) sowie dem Anschluss des Netzgerätes an eine
230-V-Netzsteckdose.
Anschließend stellen Sie das Gerät je nach Ausführung mittels des Aufstellers auf
oder hängen es mittels der in die Gehäuserückseite eingearbeiteten Aufhängeösen
an eine senkrechte Wand.

11
2.3. Beschreibung, Montage und Inbetriebnahme der Sensoren
Das Sensorkonzept der WS 3001 besteht aus zwei Gruppen von Sensoren. Grund-
sätzlich erforderlich für den Betrieb der Wetterstation ist der Innensensor S 2000 ID
(weitere Erläuterungen dazu siehe 2.3.1). Er sendet ein fest eingestelltes Daten-
telegramm. Der Sensor ist sofort einsatzbereit, da eine Adressierung nur in selte-
nen Ausnahmefällen erforderlich ist.
Erforderlich ist die Adressierung nur dann, wenn innerhalb der Sensorreichweite
(bis zu 100 m) zwei Basisstationen mit jeweils zugehörigem Innensensor betrieben
werden sollen (Basisstation 1 soll die Daten des Innensensors 1 und Basisstation 2
die Daten des Innensensors 2 anzeigen).
Auch der Regenmengensensor S 2000 R, der Helligkeitssensor S 2500 H und der
Windsensor S 2000 W sind fest adressiert und gehören so zu dieser Gruppe. Ihre
Messwerte besitzen einen festen Platz im Display (s. Seite 8, Anzeigenfeld-Über-
sicht).
Die zweite Gruppe von Sensoren sind die Typen S 2000 I, S 2001 IA , S 2000 A,
AS 2000 und ASH 2000. Diese Sensoren sind wahlweise bis zur Anzahl von max. 8
Sensoren einsetzbar und werden über die Sensorauswahl im Display angewählt.
Daher ist ihnen jeweils eine Adresse zuzuordnen. Beachten Sie daher bei diesen
Typen die Hinweise zur Adressierung.
2.3.1 Innensensor S 2000 ID
Der Innensensor S 2000 ID erfordert zum Betrieb 2 Mignonzellen. Er enthält je
einen Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensor. Er misst neben Innentempe-
ratur und Innenluftfeuchte den Luftdruck und ist Voraussetzung für die Anzeige des
Luftdrucks, der Luftdrucktendenz, der Wettertendenz und der Luftdruckhistorie.
Das Einlegen der Batterien erfolgt nach dem Öffnen der Batteriekammer auf der
Gehäuserückseite. Beachten Sie die Polaritätsangaben in der Batteriekammer und
legen Sie die Batterien entsprechend ein. Schließen Sie die Batteriekammer wie-
der. Nun können Sie den Sensor am gewünschten Montageort anbringen oder ab-
legen. Beachten Sie dabei, dass der Sensor nicht für den Betrieb im Freien oder in
Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit vorgesehen ist. Der Sensor ist nach Einle-
gen der Batterien sofort einsatzbereit.
2.3.2 Windsensor S 2000 W
Der Windsensor erfasst gleichzeitig Windrichtung und Windgeschwindigkeit am
Montageort. Er wird mit einer Solarzelle und Akkupufferung in der Dunkelheit ver-
sorgt und besitzt eine vom Anwender nicht veränderbare Adressierung.
Die Montage erfolgt entweder an einem Mast oder am oberen Abschluss einer
Wand. Wichtig für den Montageort ist die Ausrichtung der Solarzelle im Sensor-
gehäuse genau nach Süden und eine abschattungsfreie Montage, d. h., der Wind
muss frei von allen Seiten den Sensor erreichen.
Die genaue Ausrichtung des Sensors bzw. der Solarzelle nach Süden ist sehr wich-
tig, da diese Ausrichtung als Bezug für den Windrichtungsmesser dient.
Es ist auf genau senkrechte Montage des Sensors am Halterohr zu achten, um
exakte Messwerte zu erhalten.
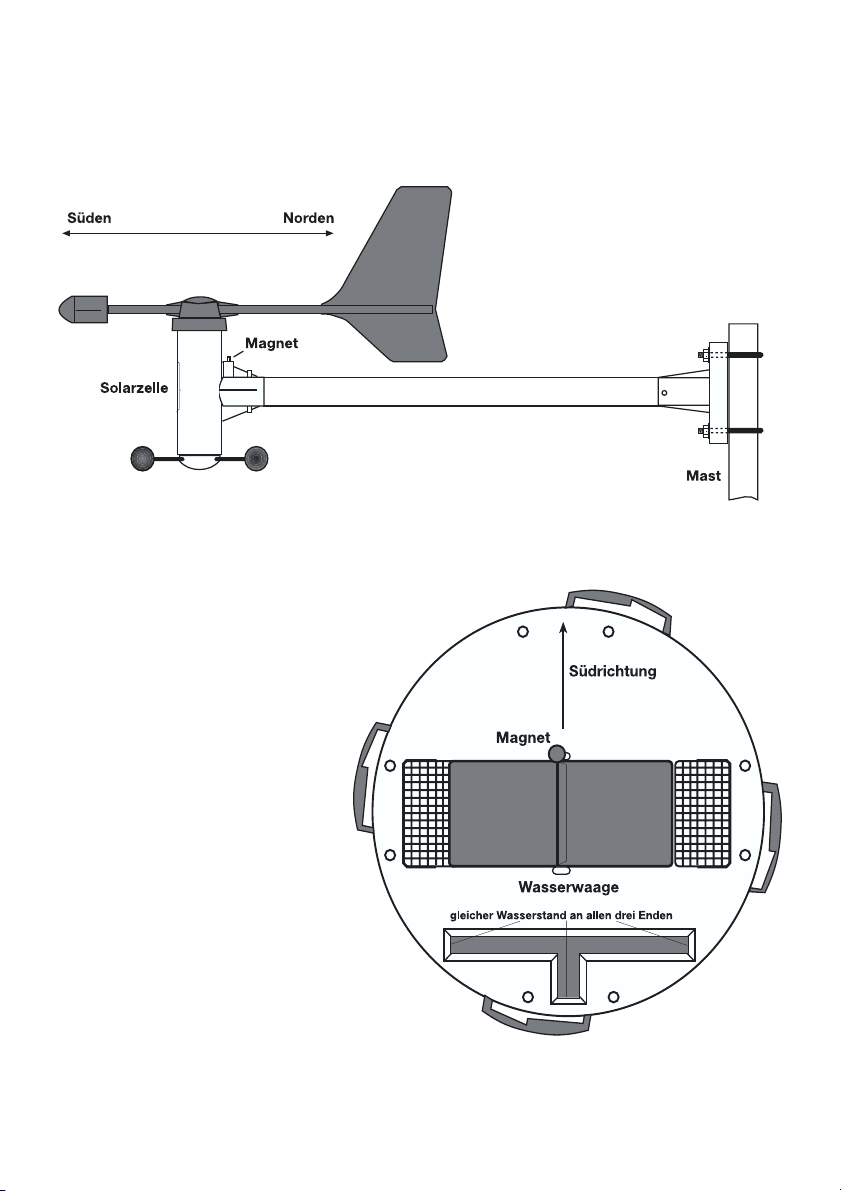
12
Verschrauben Sie abschließend das Halterohr und den Sensor für einen festen Sitz
aller Komponenten.
In der Grundausrichtung ist der Windsensor genau in Nord-Südrichtung auszurich-
ten (Solarzelle nach Süden), um den genauen Nord-Bezug für die Auswerteelek-
tronik bereitzustellen.
2.3.3 Regenmengensensor S 2000 R
Der Regenmengensensor arbei-
tet ebenfalls mit Solarstromver-
sorgung und besitzt eine vom
Anwender nicht veränderbare
Adressierung.
Hier erfolgt die Ausrichtung der
Solarzelle direkt nach Süden.
Der Regenmengensensor ist auf
einer genau waagerechten Flä-
che mittels der Befestigungs-
bohrungen am Gehäuseboden
sicher zu befestigen. Nehmen
Sie dazu zuvor das Oberteil
durch Drücken und Rechtsdre-
hen gegenüber dem Unterteil ab.
Im Unterteil ist eine Vertiefung
eingearbeitet, die, mit Wasser ge-
füllt, eine exakt waagerechte
Ausrichung auch ohne weitere
Hilfsmittel ermöglicht.
Füllen Sie ein wenig Wasser in
diese Vertiefung ein und richten
Sie dann das Gehäuseunterteil
nach dem Wasserwaagenprinzip
Ausrichtung des S 2000 R, Anwen-
dung der Wasserwaage und Lage
des Gebermagneten
Montagebeispiel des
Funk-Windsensors an
einem Mast

13
aus. Nach dem Markieren des genauen Montageortes kann das Wasser wieder
entfernt werden. Beachten Sie die Südausrichtung für die Solarzelle. Die eingear-
beitete Wasserwaage muss dabei mit ihrem kurzen Schenkel nach Norden weisen
(s. Skizze).
Um eine möglichst gute Funkabstrahlung (hohe Reichweite) zu erzielen ist es sinn-
voll, den Regenmengensensor nicht direkt auf den Erdboden zu stellen. Durch eine
Montage in ca. 1 m Höhe wird zudem die Gefahr der Verschmutzung (insbesonde-
re der Solarzelle) verringert.
Nach dem Verschrauben des Unterteils mit dem Untergrund setzen Sie das Ober-
teil wie folgt auf:
An der Zählwippe für die Wassermenge auf dem Unterteil befindet sich mittig an
der Seite ein Stabmagnet, der die Zählimpulse der Elektronik auslöst.
Das Gehäuseoberteil ist nun so aufzusetzen, dass sich die Solarzelle ebenfalls auf
der Seite des Magneten befindet, das Elektronikteil sich diesem also direkt gegen-
über befindet, und die drei Haltenasen genau in die Halterungen des Unterteils
passen. Drehen Sie das Oberteil zum Abschluss leicht nach links, bis es fest in die
Haltenasen des Unterteils einrastet.
Damit ist der Regenmengensensor einsatzbereit. Gießen Sie zum Test ein wenig
Wasser sehr langsam in den Trichter. Die aufgefangene Menge wird später im Basis-
gerät in Liter/m2, mm oder inch umgerechnet und angezeigt.
2.3.4 Helligkeitssensor S 2500 H
Der Helligkeitssensor erfasst die Helligkeit am Standort in einem Bereich zwischen
0 und 200 kLux. Er wird durch eine integrierte Solarzelle versorgt und ist ebenfalls
fest adressiert. Er ist auf den mitgelieferten Erdspieß aufzustecken und dieser in
den Boden zu stecken. Je nach Festigkeit des Bodens sollte der Erdspieß so in den
Bodengesteckt werden, dass der Sensor 20-30 cm über dem Boden sitzt, um durch
Heraufspritzen von Schmutz nicht verschmutzt zu werden.
Der Sensor ist so zu drehen, dass die Solarzelle nach Süden zeigt. Der Standort
muss frei von Abschattungen sein, die Sonne direkt auf den Messkopf treffen kön-
nen. Der Sensor ist senkrecht, mit dem Messkopf nach oben, zu montieren.
2.3.5 Adressierung der Temperatur-/Feuchtesensoren
S 2000 I, S 2001 IA, S 2000 A, AS 2000 und ASH 2000
Das Außensensorkonzept ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von bis zu 8 Außen-
sensoren, deren Daten wahlweise auf einem oder beiden oberen Anzeigenfeldern
zur Anzeige kommen. Jedem Sensor im System ist dabei eine Sensor-Adresse
zuzuordnen, die es dem Empfänger ermöglicht, den Sensor störungsfrei in das
Gesamtsystem zu integrieren. Werksseitig ist jeder Sensor als Sensor 1 eingestellt.
Die programmierbare Zuordnung ist aus nebenstehender Skizze ersichtlich.
Die Adressierung kann durch Sie selbst mittels Kodierbrücken auf der Leiterseite
der Sensorplatine vorgenommen werden. Dazu ist zunächst beim S 2000 A,
die Schutzglocke über dem Sensorgehäuse abzuschrauben. Beim AS 2000 und
ASH 2000 kann die Schutzglocke einfach abgehoben werden. Anschließend er-
folgt bei allen Sensoren das Öffnen des Gehäuses durch Entfernen der Schrauben
am Gehäuse.

14
Die Typen S 2000 I und S 2001 IA erfordern dazu nur das Abschrauben der Gehäuse-
rückwand.
Danach sind die Kodierbrücken nach obiger Adressierungstabelle zu setzen.
2.3.6 Temperatur-/Feuchtesensor S 2000 I
Der S 2000 I entspricht in Inbetriebnahme und Funktion dem S 2000 ID. Er enthält
jedoch nur einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor, keinen Luftdrucksensor. Des
Weiteren kann dieser Sensor frei für die Anzeige innerhalb des Anzeigenfeldes oben
im Display (s. Anzeigenübersicht auf Seite 8) adressiert werden. Diese Adressierung
kann nach Abschnitt 2.3.5 individuell eingestellt werden. Dieser Sensor eignet sich
aufgrund des ausschließlichen Batteriebetriebs sehr gut für den Einsatz in (dunk-
len) Innenräumen von der Garage über den Weinkeller bis zum Dachboden.
2.3.7 Temperatursensor S 2001 IA
Der S 2001 IA erfordert zum Betrieb 2 Mignonzellen. Er ermöglicht durch einen von
der Elektronik abgesetzten, gekapselten Temperatursensor an einer 1,5 m langen
Anschlussleitung die Temperaturmessung im Gartenteich, der Bodentemperatur
o. ä.
Auch dieser Sensor kann frei für die Anzeige innerhalb des Anzeigenfeldes oben im
Display (s. Anzeigenübersicht auf Seite 8) adressiert werden. Diese Adressierung
kann nach Abschnitt 2.3.5 individuell eingestellt werden.
Nun können Sie das Elektronik-Gehäuse am gewünschten Montageort anbringen
oder ablegen und den Temperatursensor am oder im gewünschten Objekt anbrin-
gen bzw. ablegen.
2.3.8 Temperatur-/Feuchte-Außensensor S 2000 A
Der Außensensor S 2000 A ermöglicht die Übermittlung der Temperatur- und
Luftfeuchtewerte am Standort des Sensors.
Auch dieser Sensor kann frei für die Anzeige innerhalb des Anzeigenfeldes oben im
Display (s. Anzeigenübersicht auf Seite 8) adressiert werden. Werksseitig sind alle
S 2000 A-Sensoren auf Sensor 1 eingestellt. Nach Abschnitt 2.3.5 ist auch eine
individuelle Adressierung möglich.
Der Montageort des Sensors sollte auf der Nord- oder Westseite erfolgen, da die
Temperaturangabe in der Meteorologie üblicherweise „im Schatten” erfolgt. Sie
3
2
1
Jumper Jumper
A0
A1
A2
A0
A1
A2
A0
A1
A2
A0
A1
A2
A0
A1
A2
A0
A1
A2
A0
A1
A2
A0
A1
A2
Sensor Sensor
8
6
5
4
7
JP1
JP2
JP3
JP1
JP2
JP3
JP1
JP2
JP3
JP1
JP2
JP3
JP1
JP2
JP3
JP1
JP2
JP3
JP1
JP2
JP3
JP1
JP2
JP3

15
können ihn auch an anderen Orten nach Wunsch anbringen. Es ist lediglich darauf
zu achten, dass die Solarzelle, die den Sensor mit Strom versorgt, stets zum Licht
ausgerichtet ist, sie muss aber nicht direkt von der Sonne beschienen werden. Der
Sensor darf nicht durch dicht davor liegende Hindernisse wie Blätter o. ä. abge-
schattet werden, hierdurch wird die Stromversorgung durch die Solarzelle gestört.
Ein denkbarer Aufbauort ist z. B. unter einem Dachvorsprung.
Der Sensor ist für die Wand- bzw. Mastmontage vorgesehen und wie folgt zu mon-
tieren: Bringen Sie den Wandhalter des Sensors entweder genau senkrecht mittels
vier Schrauben an einer Wand oder mittels des mitgelieferten Haltebügels an ei-
nem Mast an.
Setzen Sie dann den Sensor in den Wandhalter ein und verschrauben beide Teile
miteinander mittels der mitgelieferten Schraube.
Dabei muss die große Schutzglocke oben liegen und die Solarzelle zum Licht aus-
gerichtet sein.
Während der Dunkelheit und während einer Schlechtwetterperiode mit relativ we-
nig Sonnenlicht sorgt ein während ausreichender Sonneneinstrahlung durch die
Solarzelle gepuffertes internes Akkusystem für die Versorgung des Sensors.
2.3.9 Temperatur-/Feuchte-Außensensor ASH 2000
Der ASH 2000 entspricht bis auf die Art der Spannungsversorgung und dem
Befestigungsfuß dem S 2000 A. Er wird mit zwei Mignonzellen bestückt und kann
so auch an abgedunkelten oder lichtarmen Orten eingesetzt werden.
2.3.10 Temperatur-Außensensor AS 2000
Der AS 2000 entspricht bis auf die fehlende Luftfeuchtigkeitsmessung dem
ASH 2000.
2.3.11 Hinweis für die Lagerung der solarzellenversorgten Außensensoren
Diese Sensoren erhalten ihre Betriebsspannung durch eine Solarzelle, die für die
Überbrückung von Dunkelheit und Schlechtwetterperioden einen internen Akku
puffert.
Wird ein solcher Sensor für längere Zeit außer Betrieb genommen und erhält kein
Licht mehr, besteht dennoch keine Gefahr für den internen Akku, wenn die zur
Aktivierung der Betriebsspannung eingesetzten Magnete entfernt werden.
So kann der Sensor über mehrere Jahre z. B. in seiner Verpackung gelagert wer-
den.
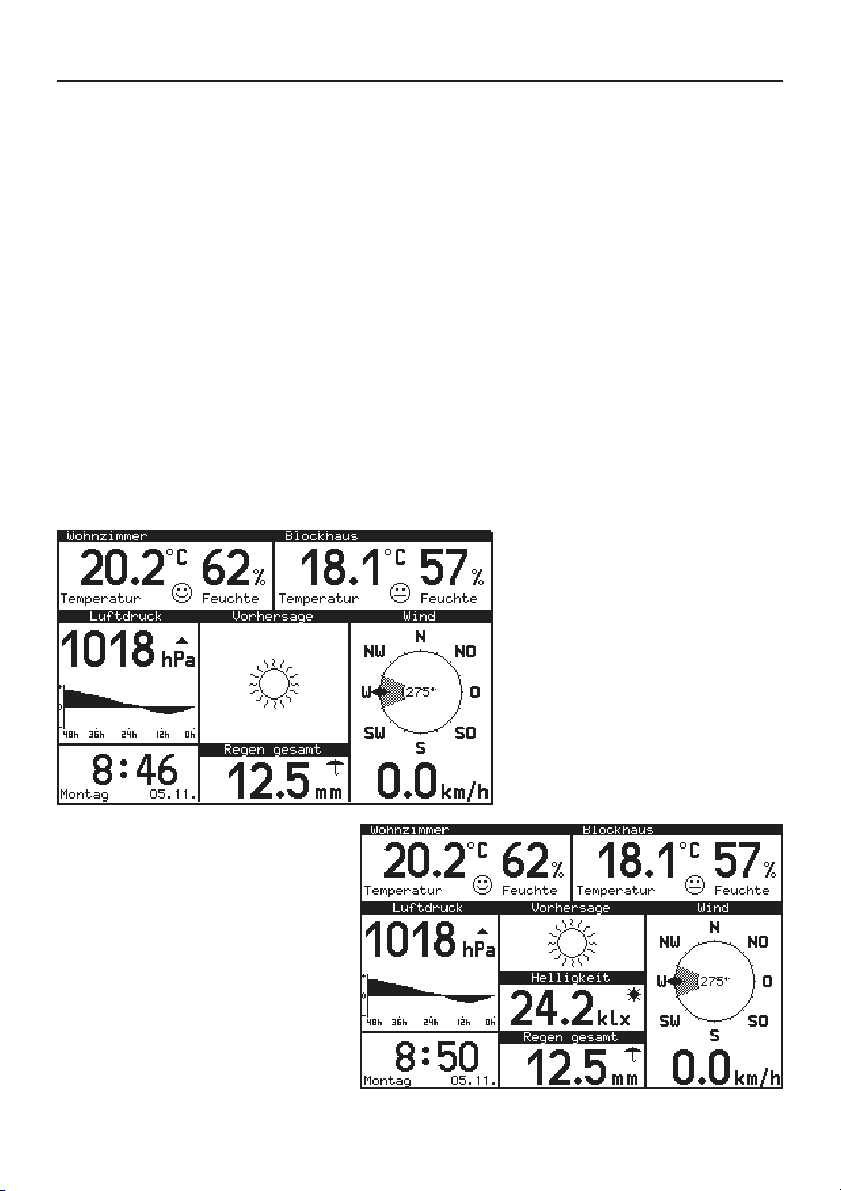
16
Die Haupt-Anzeigenfenster der Wetterstation,
oben ohne, unten mit Helligkeitssensor
Bei Bedarf, z. B. sehr beengter Anbringung an fest vorgeschriebenen Plätzen, kann die Displaydarstellung durch einen
geringfügigen Eingriff um 180 Grad gedreht werden. Kontaktieren Sie dazu unseren Service.
3. Bedienung
Nach der Inbetriebnahme des Basisgerätes und der Installation der Funksensoren
erscheinen deren gesendete und umgesetzte Daten in den entsprechenden An-
zeigenfeldern des Displays. Erfolgt die Anzeige nicht, so finden Sie im Abschnitt 7.
Hinweise zur Störungsbehebung.
Beachten Sie bitte, dass nur Daten angezeigt werden können, zu denen auch
die passenden Sensoren installiert sind. So kann z. B. ohne Regenmengen-
sensor keine Anzeige der Regenmenge erfolgen.
Da alle relevanten Daten gleichzeitig im Display erscheinen, ist die Bedienung
im Wesentlichen auf das einfache Anwählen weiterer Sensoren oder weiter-
gehender Wetterdaten durch leichtes Berühren des entsprechenden Anzeigen-
feldes beschränkt.
3.1. Grundeinstellungen
Die Wetterstation wird so ausgeliefert, dass sie sofort nach der Inbetriebnahme
ohne weitere Einstellungen betriebsfähig ist. Standardmäßig erscheinen links oben
im Display die Daten für den Innensensor, rechts die Daten des Außensensors 1.
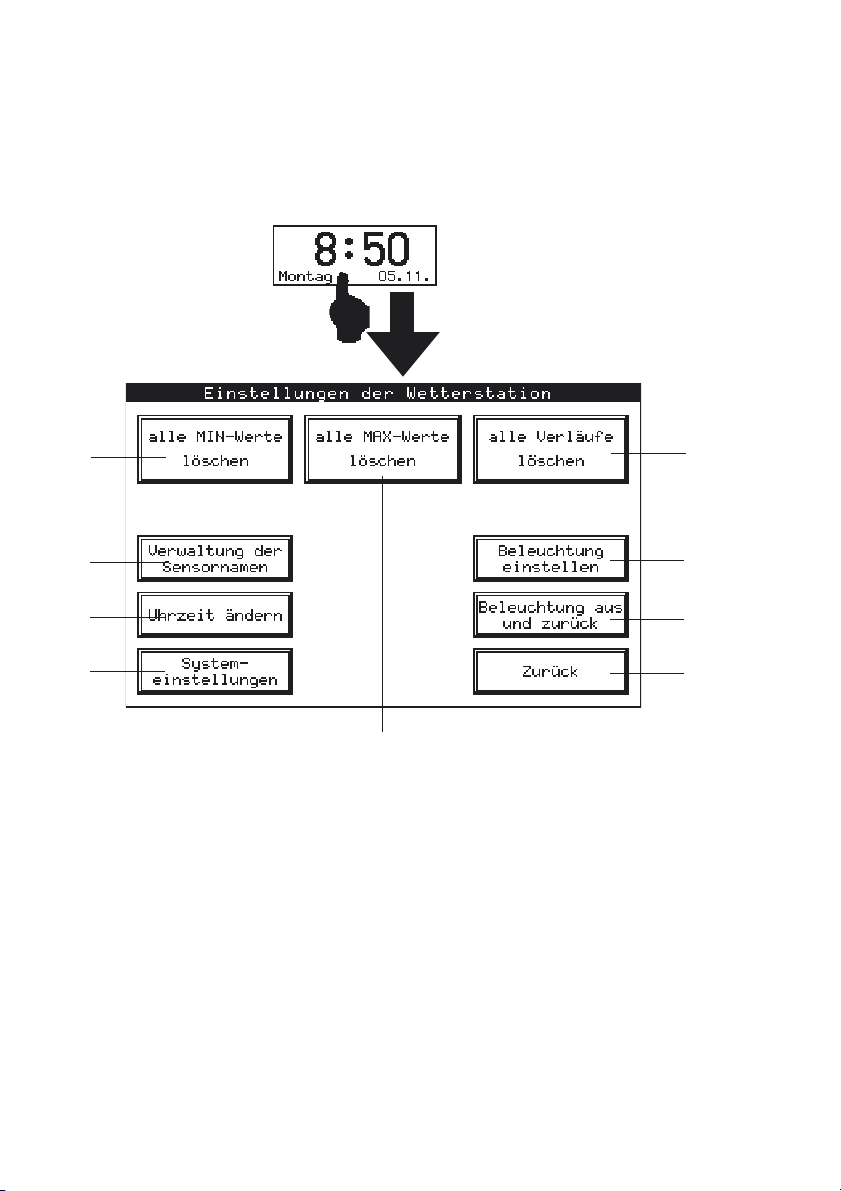
17
1 Sensorfeld für zentrale Löschung aller gespeicherten Minimalwerte
2 Sensorfeld für zentrale Löschung aller gespeicherten Maximalwerte
3 Sensorfeld für zentrale Löschung aller gespeicherten Messwertverläufe
4 Sensorfeld zum Sprung in die Sensornamenverwaltung
5 Sensorfeld zum Sprung in die Uhrzeitverwaltung
6 Sensorfeld zum Sprung zu den Systemeinstellungen
7 Sensorfeld zum Sprung zu den Beleuchtungseinstellungen
8 Sensorfeld zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung und Rückkehr in die
Hauptanzeige. Eine ausgeschaltete Beleuchtung schaltet sich entweder beim
nächsten Funkbefehl der Fernsteuerung oder beim nächsten Berühren des
Touch-Screen-Displays ein.
9 Sensorfeld für die Rückkehr in die Hauptanzeige
Uhrzeit-/Datumsanzeige
1
4
5
6
2
3
7
8
9
Darüber hinaus sind zahlreiche Parameter manuell einstellbar. Durch Berühren des
jeweiligen Tastenfeldes „Zurück” gelangen Sie immer wieder zum vorherigen bzw.
Haupt-Anzeigenfenster zurück.
Durch Berühren des Anzeigenfensters für Uhrzeit/Datum gelangen Sie in das Ein-
stellmenü, über das alle wichtigen Einstellfunktionen der Wetterstation erreichbar
sind.
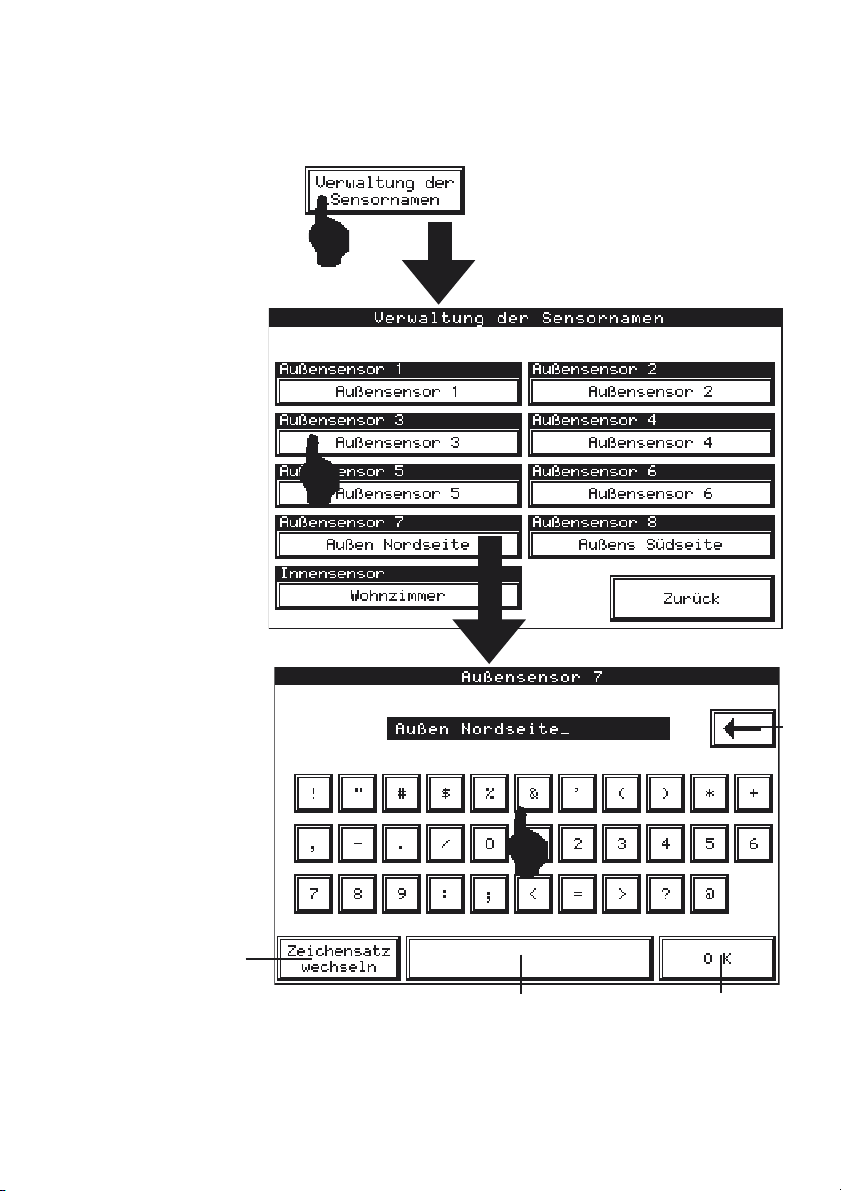
18
Einstellmenü,
Sensorfeld
„Verwaltung der Sensornamen”
Auswahl des zu benennenden
Sensors, z. B. Außensensor 3
Eingabe des Sensornamens über
die alphanumerische Tastatur.
Sondertastenbeschreibung siehe
unten.
Abschluss der Eingabe mit OK-
Taste.
1
23
4
Sondertasten:
1 Zeichensatzwechsel (Groß-/Kleinschreibung, Sonderzeichen/Ziffern)
2 Leertaste
3 Bestätigung der Eingabe und Rückkehr zur Sensornamenverwaltung
4 Rückschritttaste (zum Löschen bzw. Fehlerkorrektur)
3.1.1. Sensornamenverwaltung
Sie können jedem der 8 Außensensoren und dem Innensensor einen individuellen
Namen zuweisen. Dieser kann bis zu 24 Zeichen lang sein. Die Zuweisung ge-
schieht wie folgend dargestellt:
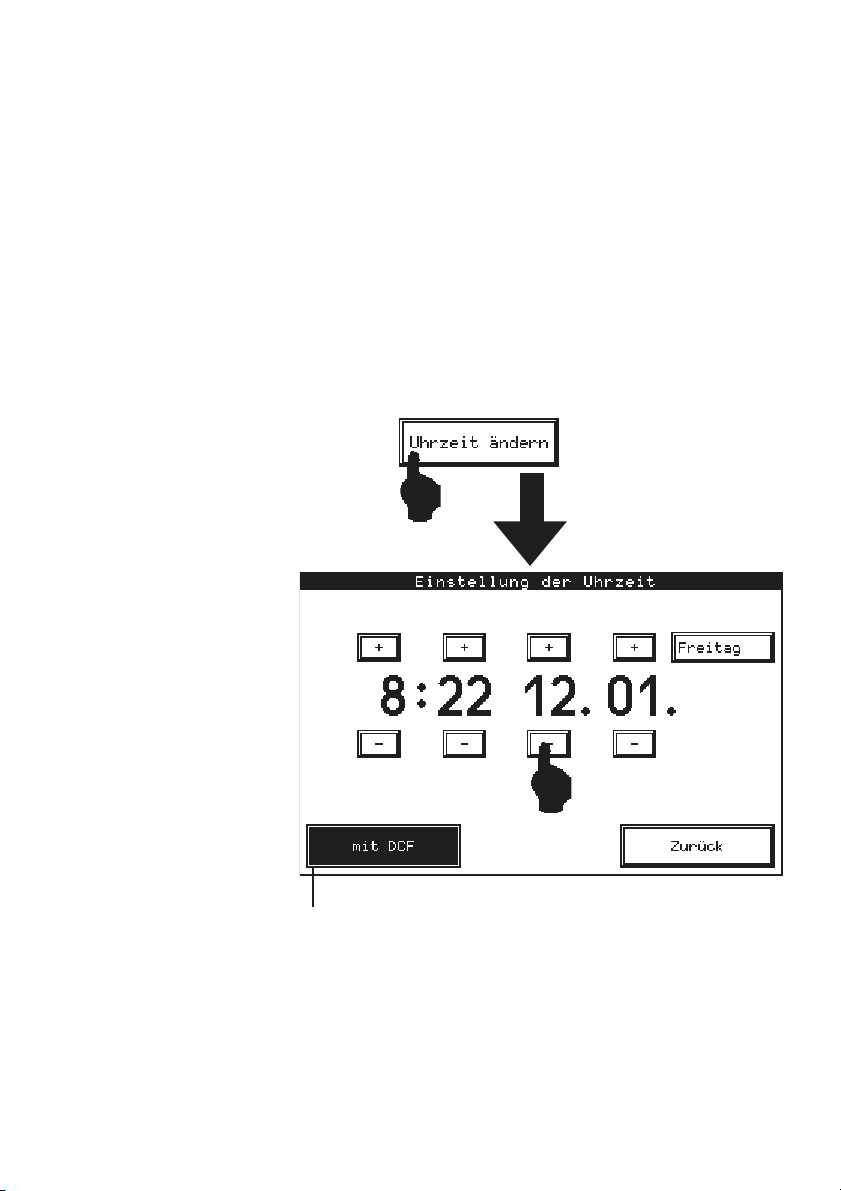
19
3.1.2. Uhrzeit einstellen/ändern, DCF-Empfang aktivieren/deaktivieren
Sie können die Uhrzeit und das Datum mit Wochentag sowohl manuell eingeben
als auch automatisch durch das DCF-77-Zeitsendersignal der PTB Braunschweig,
ausgesendet durch den Langwellensender Mainflingen bei Frankfurt/Main, anzei-
gen lassen.
Die manuelle Uhrzeit-/Datumseinstellung ist eine praktische Möglichkeit, die exak-
te Uhrzeit mit Datum auch einstellen zu können, wenn der DCF-Empfang zum Zeit-
punkt der Inbetriebnahme oder durch einen ungünstigen Standort der Wetterstati-
on nicht möglich ist.
Einstellmenü,
Sensorfeld „Uhrzeit ändern”
Uhrzeit, Datum und Wochentag
durch Berühren der Display-
felder +/- bzw. Wochentag ein-
geben.
Abschluss der Eingabe mit Tas-
te „Zurück”
Aktivierung/Deaktivierung der Synchronisation von Uhrzeit/Datum mit dem
Zeitzeichensender DCF 77
(Dunkel: mit DCF-Empfang; Hell: ohne DCF-Empfang)
Bitte beachten:
Der Empfang des DCF-77-Zeitsendersignals ist in einem Umkreis von ca. 1500 km um Frankfurt/Main möglich. Au-
ßerhalb dieser Reichweite läuft die Uhr nach manueller Einstellung als genaue Quarzuhr.
Hinweis:
Der DCF-Empfang erfolgt immer nachts um 3 Uhr. Weitere Versuche bei Störungen erfolgen um 4:00, 5:00 und
6:00. Während des DCF-Empfangs ist kein Empfang der Sensoren oder der Fernbedienung möglich.
Da laufende Fernsehgeräte sowie die Beleuchtung der WS3001 den DCF-Empfang stark beeinträchtigen, sollte
sichergestellt sein, dass um 3 Uhr nachts keines von beiden aktiv ist.
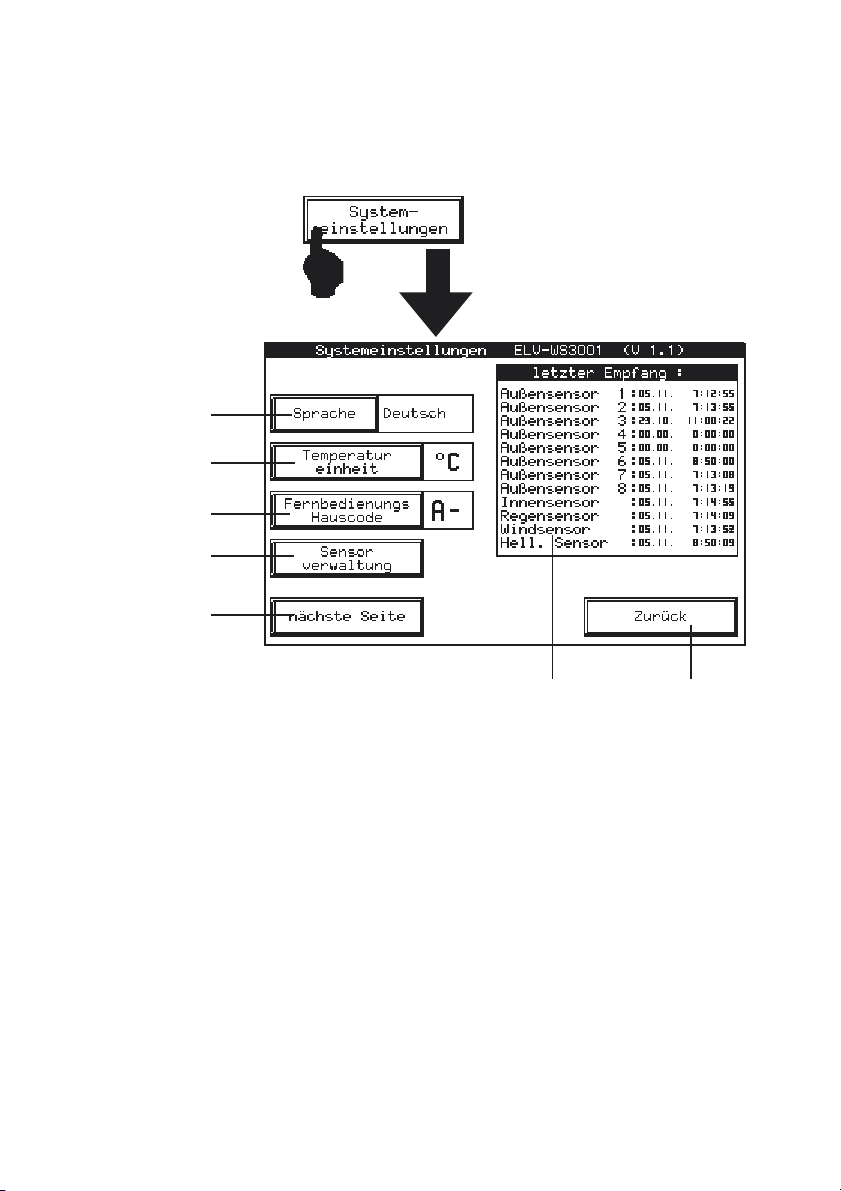
20
3.1.3. Systemeinstellungen
Das Menü „Systemeinstellungen” erlaubt sowohl die Einstellung einer Reihe von
Systemparametern als auch eine Übersicht über den Zeitpunkt des letzten Daten-
empfangs jedes der bis zu 12 verwaltbaren Wettersensoren. Dies erlaubt z. B. die
Analyse von Empfangsstörungen.
Einstellmenü,
Sensorfeld „Systemeinstellungen”
1
4
5
2
3
67
1 Sprachauswahl: Hier erfolgt die Auswahl der Anzeigen- und Dialogsprache
2 Einstellung der Anzeigeneinheit für die Temperatur
3 Einstellung des Hauscodes der Funkfernbedienung FS 10-S8 zum Betrieb meh-
rerer Funkfernbediensysteme nebeneinander. „A” steht dabei für die Fernbe-
dienung FS 10 S8, „B” für eine später geplante Spezial-Fernbedienung. Die
Auswahl 1-8 entspricht den möglichen Hauscodes der Fernbedienung (genaue
Beschreibung siehe Abschnitt 5. „Fernbedienung”). Wird „A-” gewählt, so wird
der Hauscode nicht beachtet.
4 Sensorfeld zum Sprung zur Sensorverwaltung (siehe Abschnitt 4 „Sonderein-
stellungen”).
5 Sensorfeld zum Sprung zur zweiten Seite der Systemeinstellungen.
6 Anzeigenfeld für den Zeitpunkt des jeweils letzten Empfangs jedes Sensors.
7 Einstellungen bestätigen und zurück zum Einstellmenü.
Table of contents
Languages:
Other elv Weather Station manuals
Popular Weather Station manuals by other brands

elsner elektronik
elsner elektronik P03/3-RS485-WAGO manual
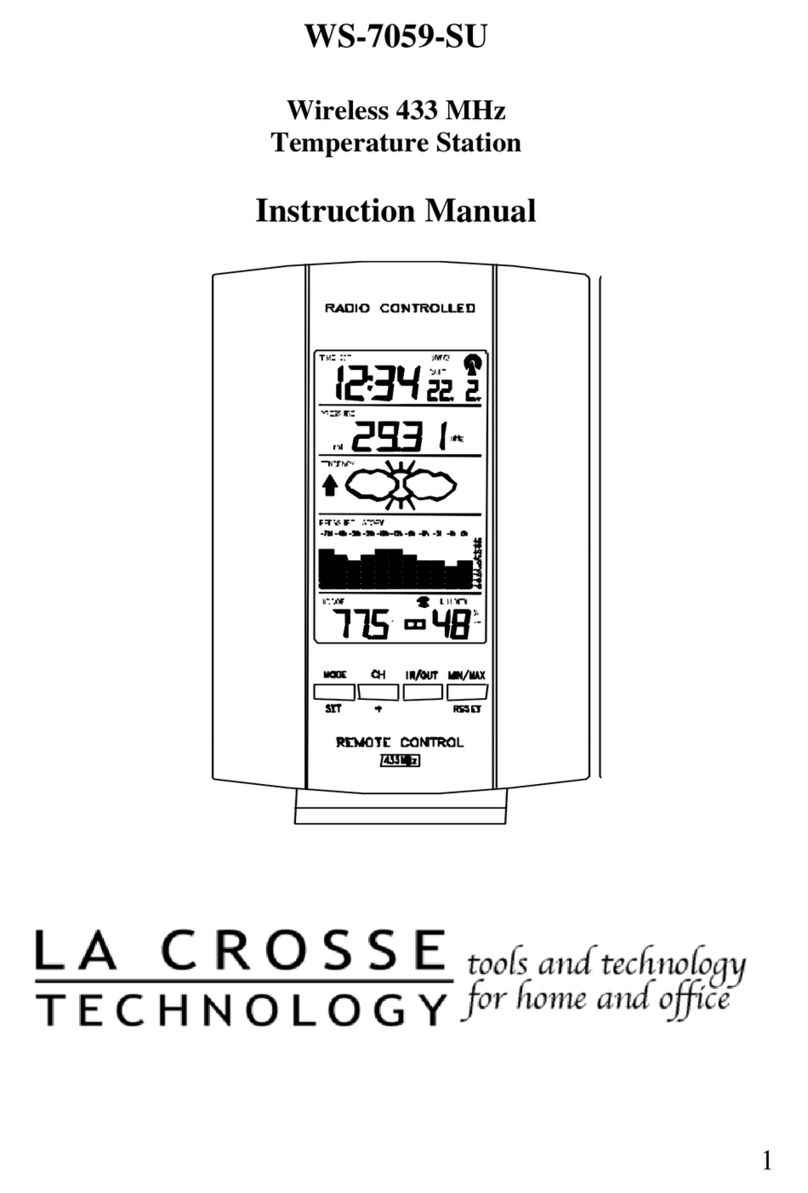
La Crosse Technology
La Crosse Technology WS-7059-SU instruction manual

Auriol
Auriol Z29536 Operation manual

La Crosse Technology
La Crosse Technology WS-9043U instruction manual

Hama
Hama EWS Intro operating instructions

La Crosse Technology
La Crosse Technology Wireless Weather Station instruction manual