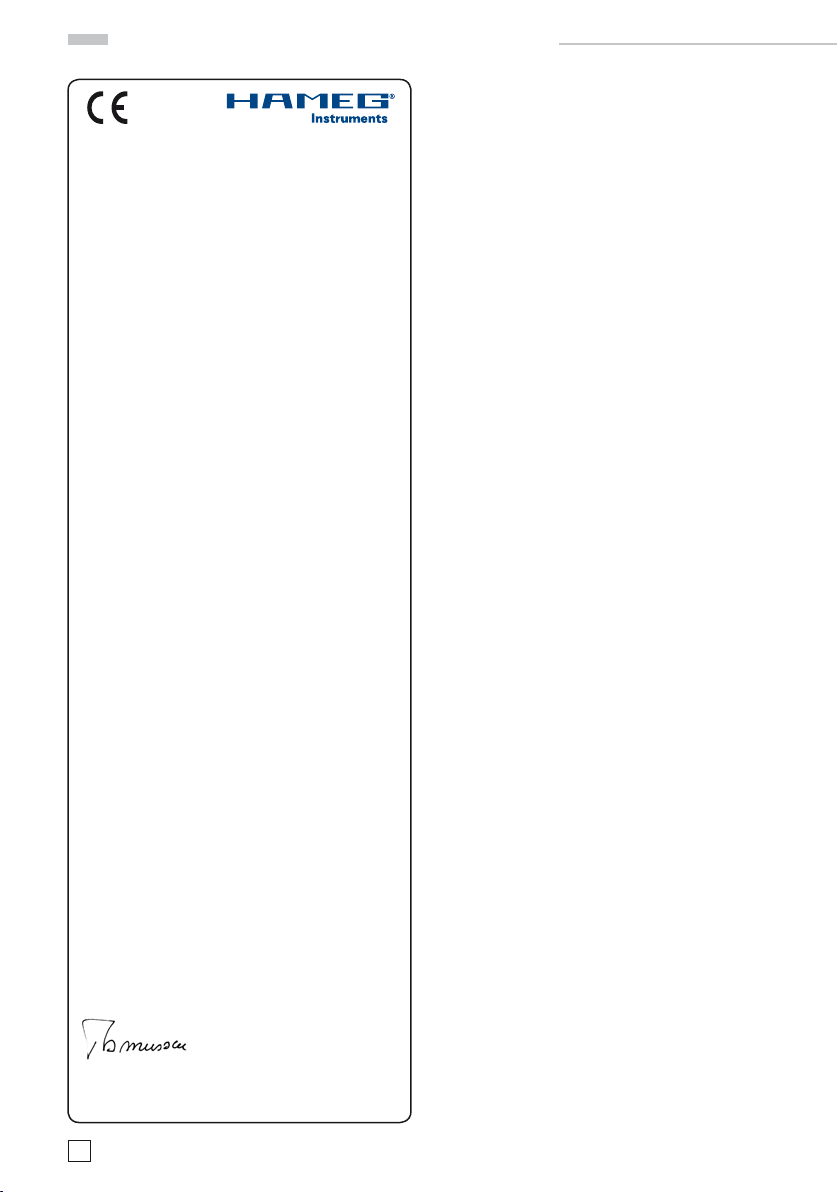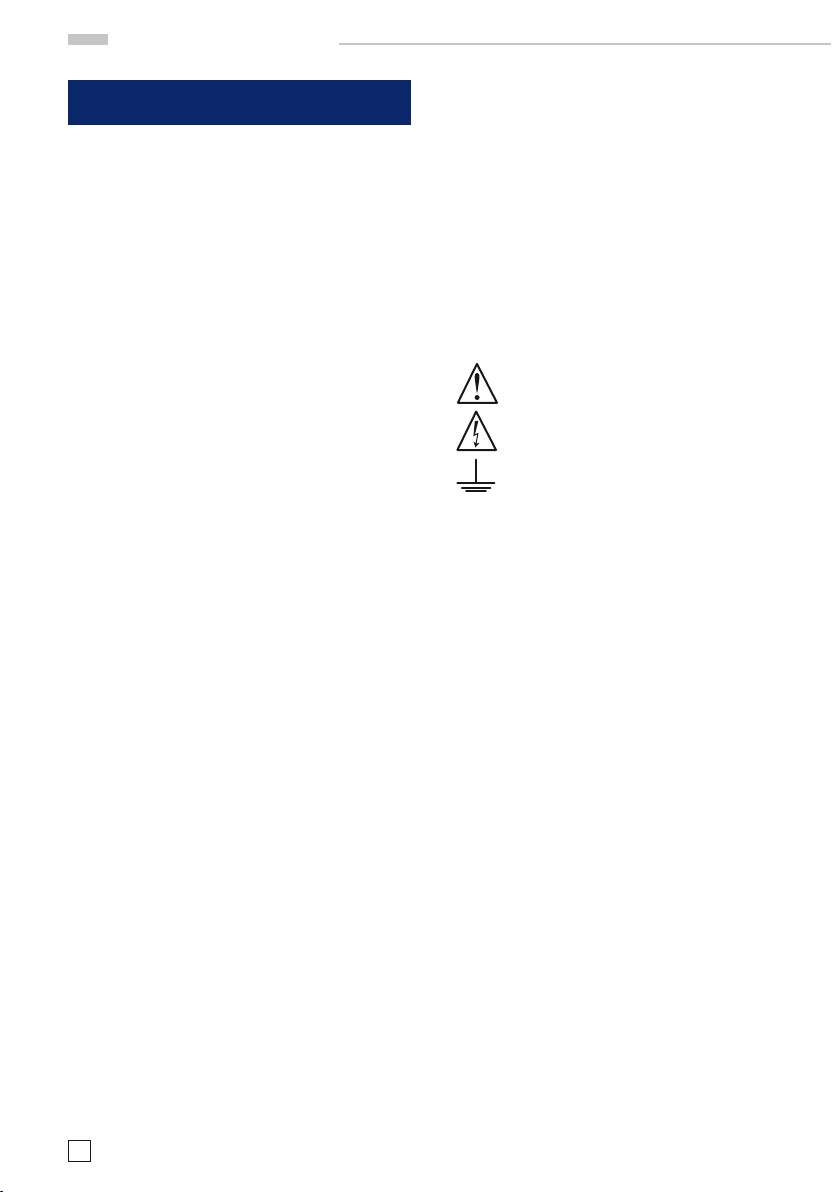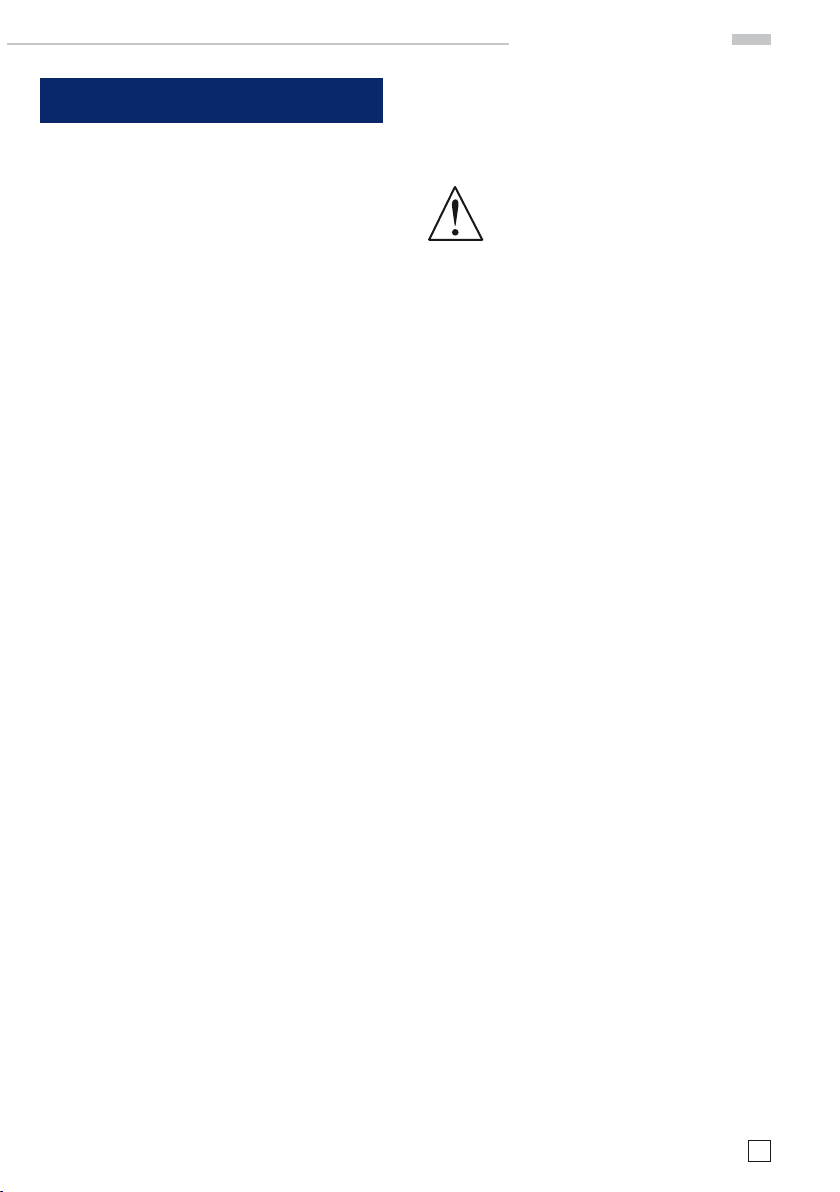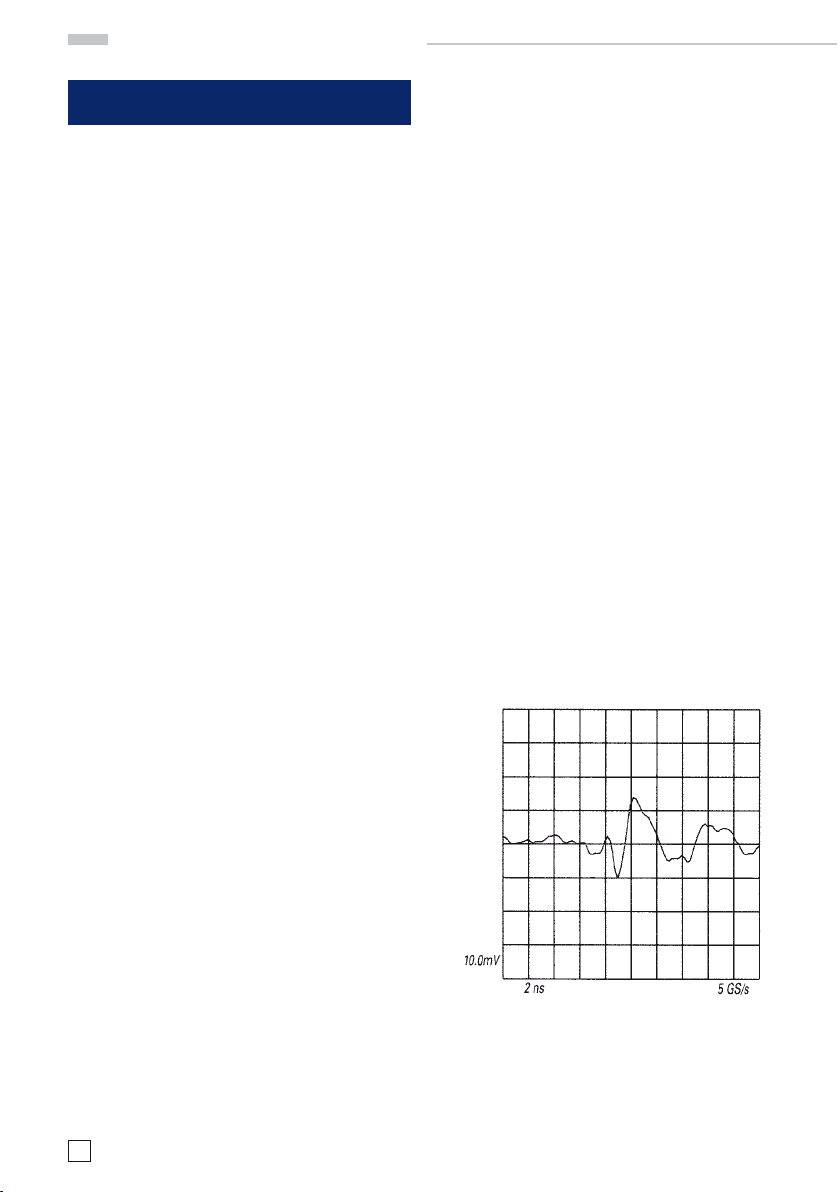8Änderungen vorbehalten
Al l g e m eine s A l l g e m e i n e s
Allgemeines
Entwickler und Hersteller von elektrischen und
elektronischen Geräten sind verpflichtet, die
Verträglichkeit der eigenen Geräte im Sinne der
EMV-Richtlinie sicherzustellen. Die Erkenntnis,
Störsicherheit lässt sich nicht durch nachträg-
liche Prüfung erzielen, sondern muss über alle
Stufen einer Entwicklung erarbeitet werden, steht
außer Frage. Dabei muss EMV nicht teuer sein.
Einfache Hilfsmittel für den Bereich der entwick-
lungsbegleitenden Messtechnik halten Aufwand
und Kosten für die EMV-Sicherheit in einem
überschaubaren Rahmen. HAMEG bietet für diese
Untersuchungen kostengünstige Geräte für die
EMV-Pre-Compliance Messtechnik an.
HAMEG Spektrumanalysatoren, Netznachbil-
dungen und Nahfeldmesssonden für den Einsatz
bei der entwicklungsbegleitenden EMV-Mess-
technik bieten die richtige Hilfestellung wenn es
darum geht, schnell und kostengünstig nachprüf-
bare Ergebnisse zu erzielen.
Eigenschaften der Sonden
Die nach ergonomischen Gesichtspunkten aus-
gewählte Sondenform läßt sich gut handhaben.
Auf Grund der geringen Baugröße sind auch
Messungen an ungünstig zugänglichen Stellen
möglich. Die Spannungsversorgung der Sonden
erfolgt direkt aus einem HAMEG Spektrumana-
lysator. Lösungen zur Spannungsversorgung bei
Verwendung von Geräten anderer Hersteller sind
optional als Zubehör vorhanden. Die Sonden haben
eine Ausgangsimpedanz von 50 Ohm und lassen
sich sowohl an Spektrumanalysatoren, Messemp-
fängern und Oszilloskopen verwenden.
EMV-Nahfeldsondensätze
HZ540 und HZ550
HAMEG Nahfeld-Sondensätze für die EMV-Pre-
compliance-Messtechnik bestehen aus verschie-
denen Breitbandsonden mit unterschiedlicher
Empfangscharacteristik. Die Sonden werden in
Verbindung mit Spektrumanalysatoren, Mess-
empfängern oder Oszilloskopen zur qualitativen
Erfassung elektromagnetischer Strahlung ein-
gesetzt. Sie dienen vor allem zur Diagnose von
Störemissionen auf Leiterplatten, von integrierten
Schaltungen, Kabeln, Leckstellen in Schirmungen
und ähnlichen Störstrahlungsquellen. Die HAMEG
Sondensätze HZ50 und HZ550 sind entsprechend
der gewünschten Aufgabenstellung unterschied-
lich zusammengestellt.
Die Sondensätze enthalten in der Basisausstat-
tung eine aktive Magnetfeldsonde, einen aktiven
E-Feld-Monopol und eine aktive Hochimpe-
danzsonde. Abweichend vom Basissatz HZ50
ist der HZ550 um zusätzliche Sonden wie eine
µH-Feld-Sonde und eine passive Einstrahlsonde
erweitert.
Beschreibung der Sonden
E-Feld-Sonde HZ551
Die E-Feld-Sonde hat die höchste Empndlichkeit
der zum Einsatz kommenden Sonden und nimmt
Störstrahlungen im gesamten spezifizierten
Frequenzbereich omnidirektional auf. Sie wird
verwendet, um die Gesmtabstrahlung einer
Baugruppe oder eines Gerätes zu erfassen und
ermöglicht, sich einen ersten Überblick des Stör-
spektrums zu verschaffen. So dient die Sonde z. B.
dazu, um ein Ergebnis einer EMV-Prüfung durch
einen Dienstleister nachzuvollziehen, oder einfach
die Wirkung von Abschirmmaßnahmen zu prüfen.
Ferner kann man mit der E-Feld-Sonde Relativ-
messungen zu Abnahmeprotokollen durchführen.
Üblicherweise wird die Messung mit dieser Sonde
in einem Abstand von ca. 1m vom Messobjekt
durchgeführt.
H-Feld-Sonde HZ552
Die mit der E-Feld-Sonde ermittelten Störfre-
quenzen lassen sich dann mit der H-Feld-Sonde
im Nahbereich der Störquelle lokalisieren. Die
Sonde HZ55 hat konstruktionsbedingt eine hohe
Auösung. Mit ihr kann man kann z. B. schnell
feststellen welcher IC stark stört, Abschirmungen
auf „undichte“ Stellen untersuchen und Kabel
oder Leitungen auf mitgeführte Störleistungen
absuchen. Dabei ist die HZ55 wegen der geringen
Baugröße hervorragend für die Lokalisierung von
Störgrößen an ungünstig zugänglichen Stellen
oder für die Messung an sehr kleinen Störquellen,
z. B. SMD-Bauformen, geeignet.
µH-Feld-Sonde HZ554
Die µH-Feld-Sonde dient zur Untersuchung von
H-Feldern an kleinsten SMD-Bauformen und auf
Leiterbahnen, sowie zur Detektion von Störströ-
men in Masseleitungen. Die Sonde ist empndlich
für Änderungen des magnetischen Flusses und