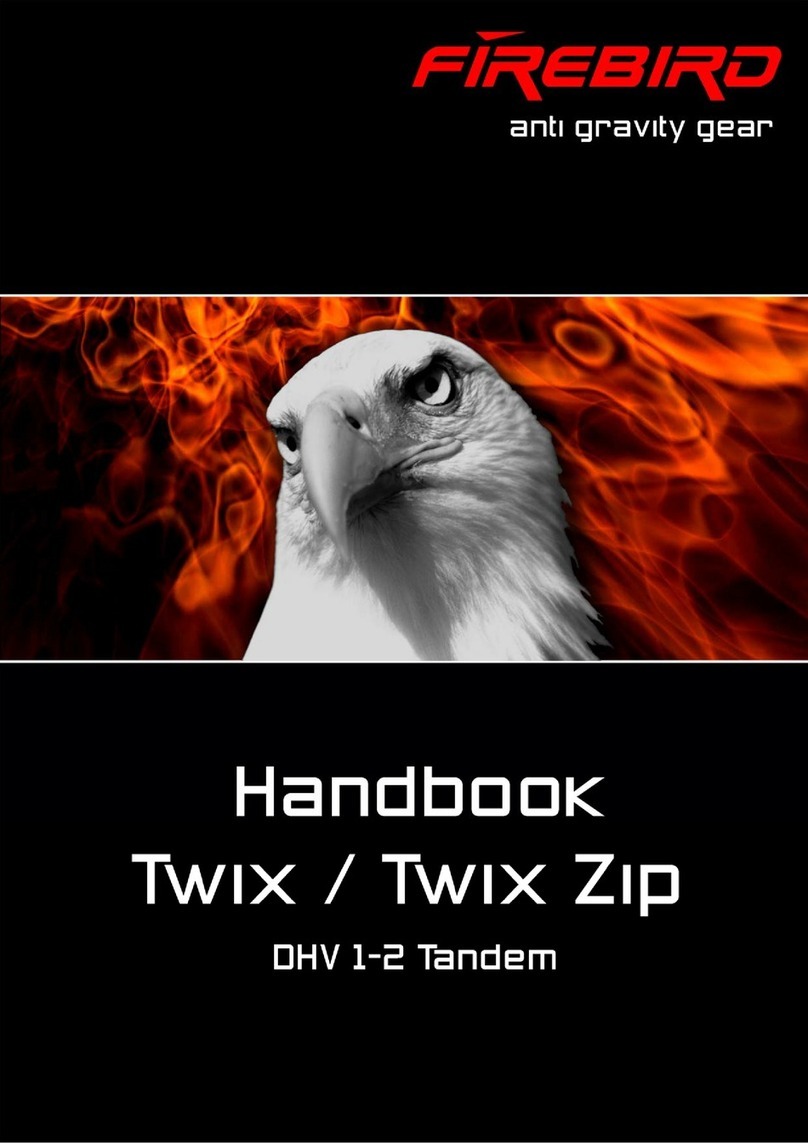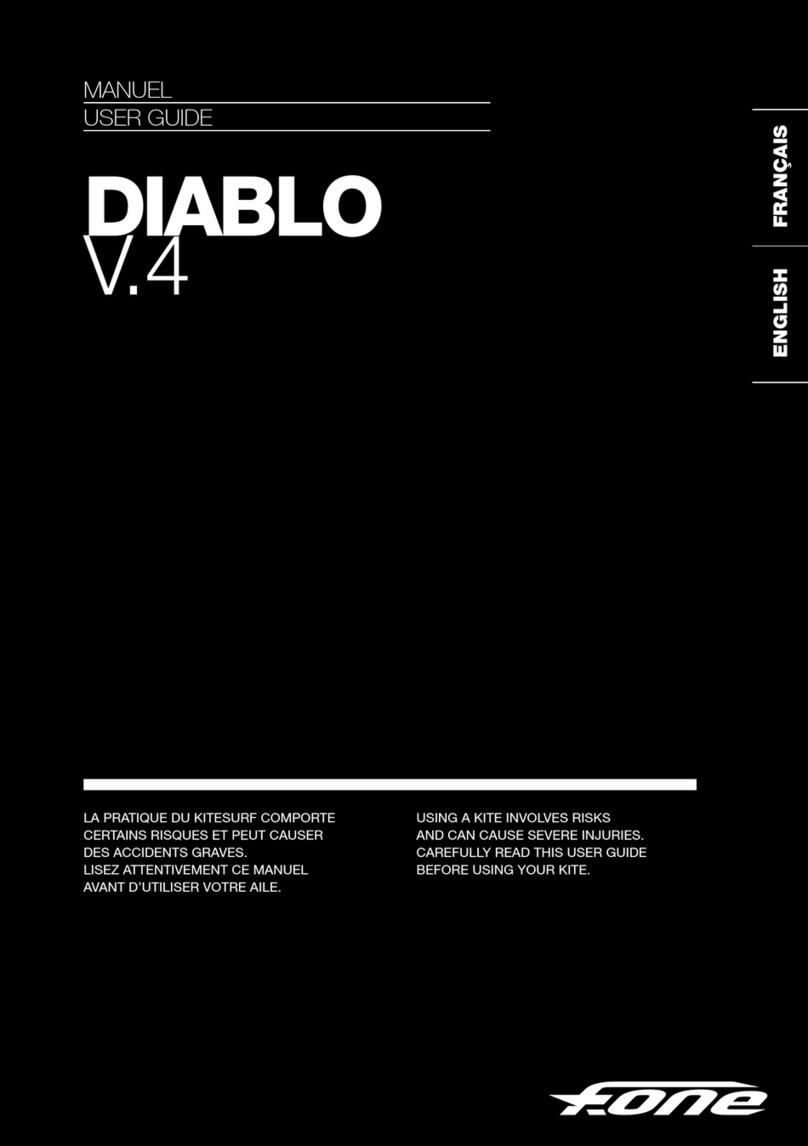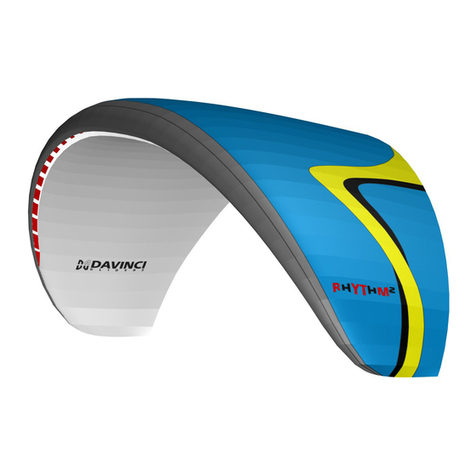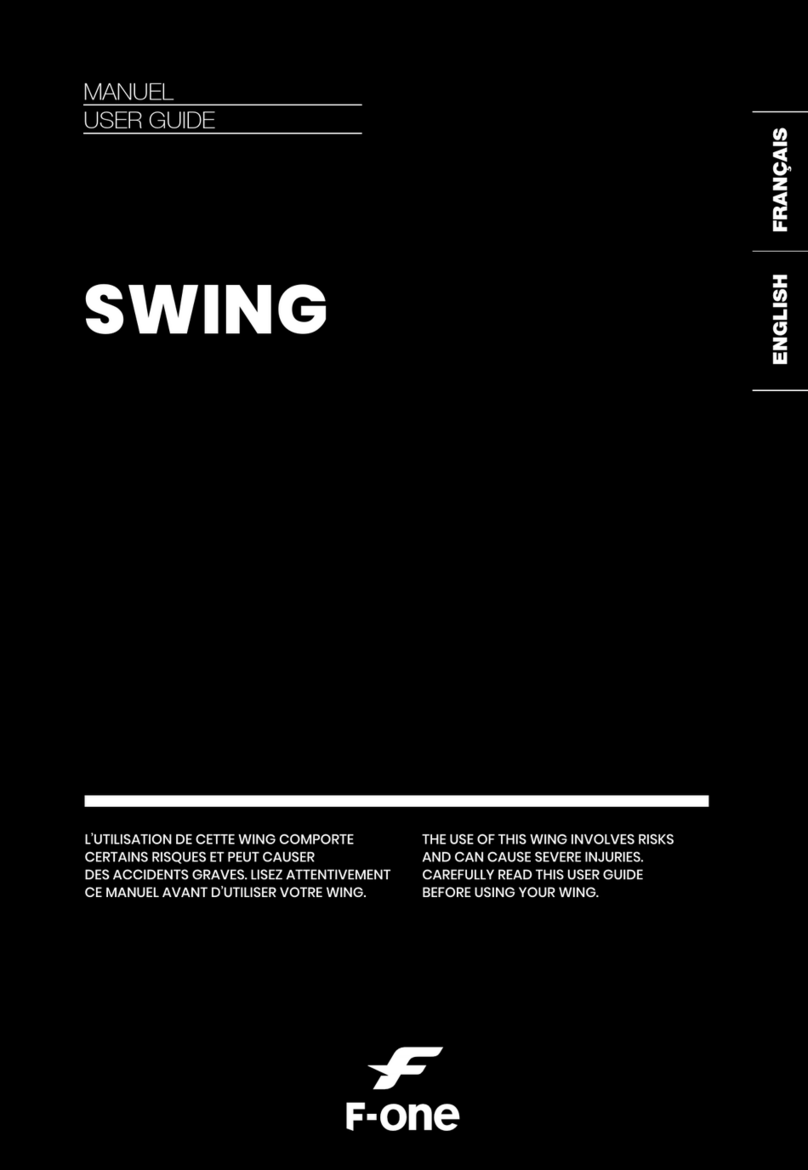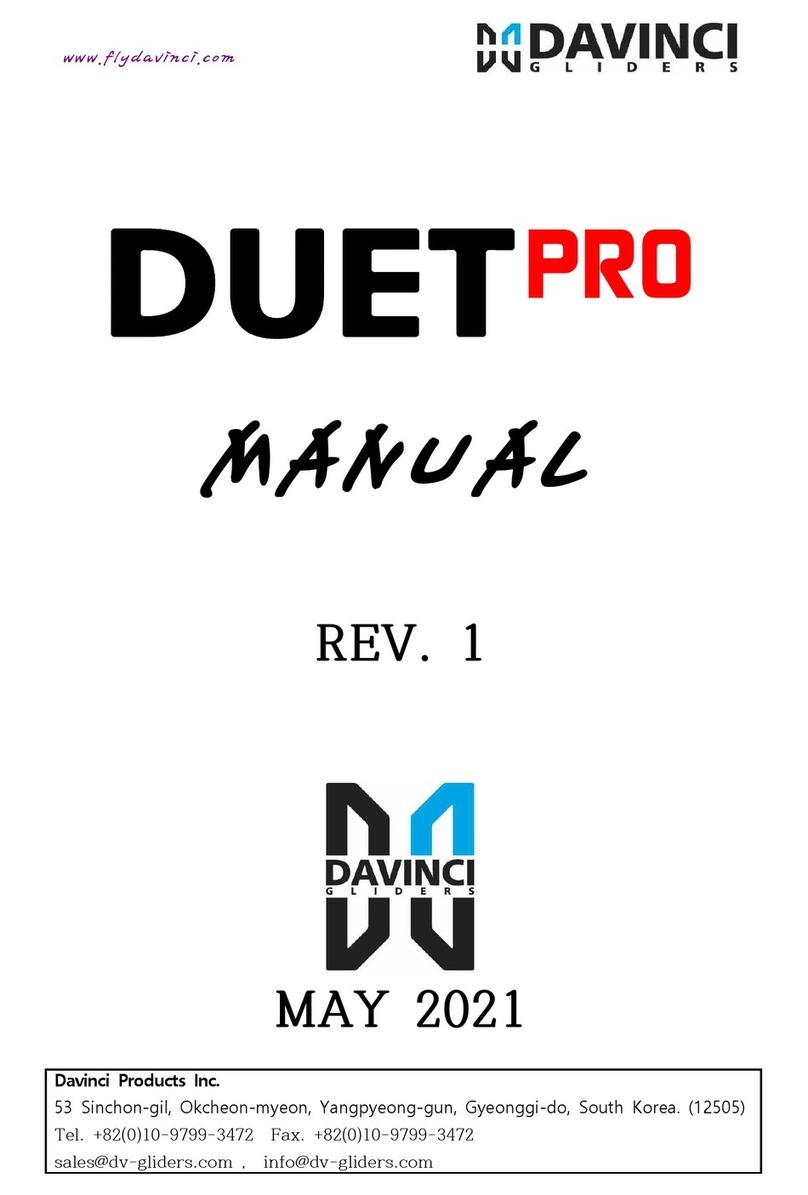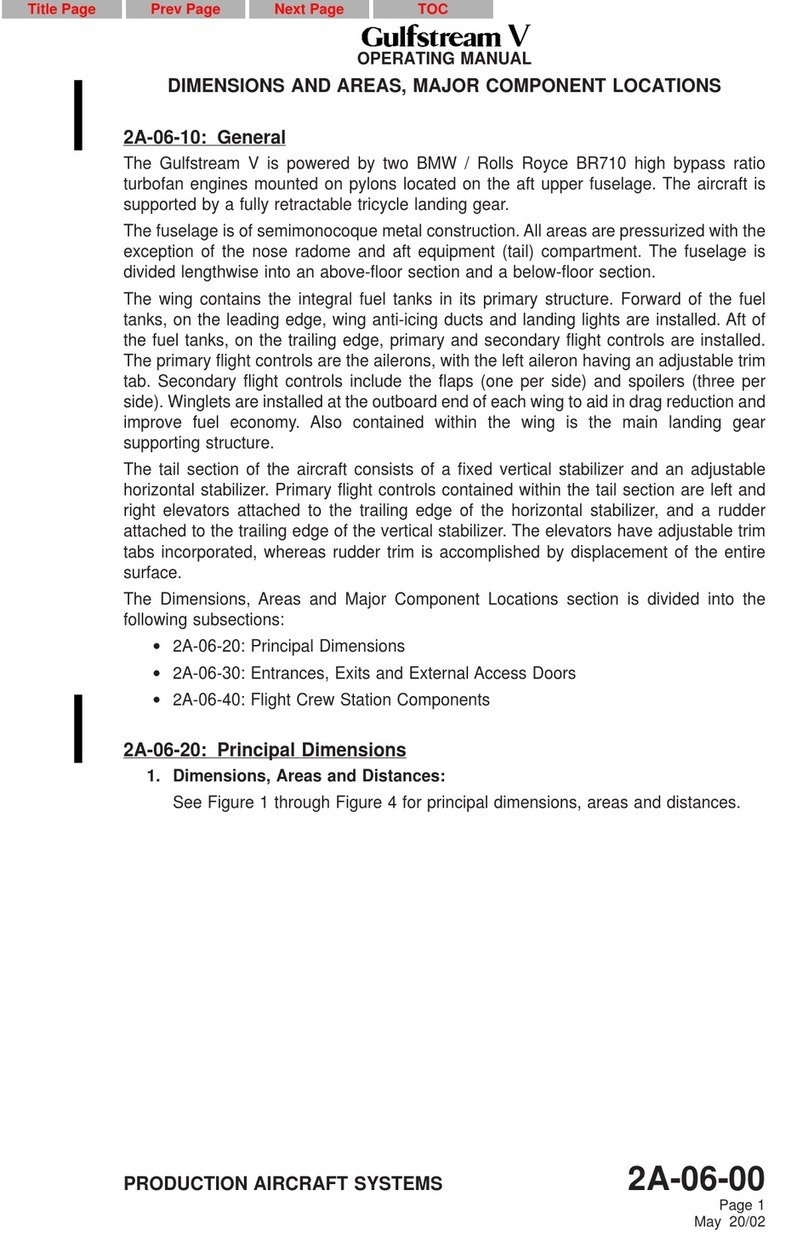FireBird Z-ONE User manual



Z One
DHV 1
Betriebs-Handbuch Deutsch
Manuel d’utilisation Française
Handbook English
Betriebs-Handbuch Stand 1.1.2005
Vorab herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FIREBIRD Z-ONE. Der Z-ONE
ist der erste DHV 1er von FIREBIRD und weit mehr als ein Schulschirm. Wir
haben unsere ganzen Erfahrungen aus 27 Jahren Entwicklung eingebracht,
um perfekte Sicherheit mit dem Handling eines Fun-Schirmes zu vereinen. Wir
sind sicher, dass ihr ihn lieben werdet. Als Meisterstück etikettiert der Z-ONE
seine Klasse. Mit ihm wird der Anreiz auf einen Intermediate aufzusteigen
verfallen. Die DHV-Klasse 1 wird erteilt für Gleitschirme mit einfachem,
weitgehend Fehlerverzeihendem Flugverhalten.
Dieses Betriebshandbuch enthält wichtige Informationen über das Fliegen und
den Umgang mit Ihrem neuen Z-ONE. Es wurde von uns sorgfältig
zusammengestellt. Deshalb bitten wir jeden Piloten darum, diese Anleitung vor
dem ersten Flug mit dem Z-ONE eingehend zu studieren und sich bei offenen
Fragen mit uns in Verbindung zu setzen.
Aber jetzt viel Spaß beim Fliegen
Dein Firebird Team

ALLGEMEINE BETRIEBSHINWEISE
Anhang _________________________________ 9
Gerätebeschreibung _______________________ A
Technische Daten_________________________ B
Dein FIREBIRD Gleitschirm _________________ 1
Qualitätskontrolle 1.1
Überprüfen des Gerätes 1.2
Einstellung der Bremsleinen 1.3
Start ___________________________________ 2
Wichtig - trockener Schirm 2.1
Startvorbereitungen 2.2
Start-Check 2.3
Startverhalten 2.4
Windenschlepp 2.5
Firebird Schlepp-Support 2.6
Flugtechnik ______________________________ 3
Geradeausflug/Geschwindigkeit 3.1
Speedsystem 3.2
Kurvenflug 3.3
Aktives Fliegen 3.4
Landung 3.5
Abstiegshilfen ____________________________ 4
Steilspirale 4.1
B-Stall 4.2
Ohren anlegen 4.3
Extremflugmanöver________________________ 5
Einklapper 5.1
Frontale Einklapper 5.1
Seitliche Einklapper 5.1
Einklapper mit Verhänger 5.1
Sackflug 5.2
Fullstall 5.3
Trudeln 5.4
Bremsenausfall 5.5
Motorisiertes Fliegen 5.6
Kunstflug 5.7
Lagerung, Pflege, Reparatur_________________ 6
Packen des Gleitschirmes 6.1
Klett-Öffnung 6.2
UV-Strahlung 6.3
Lagerung 6.4
Reinigung 6.5
Umgang am Boden 6.6
Insekten 6.7
Reparaturen am Segeltuch 6.8
Beschädigung der Leinen 6.9
Leinenschlösser 6.10
Wartungsintervall _________________________ 7
Instandhaltungsanweisung __________________ 8

A. Gerätebeschreibung
Materialien
Die von uns verwendeten High-Tech-Materialien bewähren sich durch ihre
extreme Langlebigkeit und Resistenz und sind Voraussetzung für die
hochwertige Herstellung von FIREBIRD-Gleitsegeln. Ein ordnungsgemäßer
Umgang mit der Ausrüstung sorgt für einen langjährigen Qualitätserhalt.
Die Kappen der FIREBIRD-Schirme werden aus 40 g/qm Porcher Marine
Nylon Ripstop Material gefertigt (Softfinish für Ober- und Untersegel,
Hardfinish für Profilrippen, speziell wasserabweisend für das Obersegel).
In diesen synthetischen Stoff ist ein verstärkendes Fadennetzwerk
eingearbeitet, das ein Weiterreißen bei eventueller Beschädigung verhindert.
Um Luftdurchlässigkeit zu verringern und Wasser- bzw. UV-Beständigkeit zu
erhöhen, ist dieser Stoff mit einem speziellen Coating überzogen.
Unsere vom DHV zugelassenen Leinen bestehen aus einem ARAMID-Kern
mit Polyester Ummantelung. Das Material wird für die Musterzulassung durch
tausendfaches Knicken und Belasten geprüft.
Kappenaufbau
Die Kappe des Z-ONE setzt sich aus 40 Zellen zusammen. An der Vorderseite
speziell geschnittene Eintrittsöffnungen leiten den durch den Fahrtwind
erzeugten Staudruck in die Kappe. Sein Profil erhält der FIREBIRD Z-ONE
durch Profil- und Diagonalbänder, die Ober- und Untersegel verbinden und
auftretende Kräfte gleichmäßig auf die daran angehängten Leinen verteilen.
Druckausgleichsöffnungen in den Zellwänden sorgen für eine homogene
Druckverteilung in der Kappe. Profilgebung und Grundform verleihen dem Z-
ONE seine bemerkenswerte Stabilität auch in Extremsituationen.
Die beiden Ram-Air-Stabilisatoren geben dem Schirm durch ihre Formgebung
eine höhere Flugstabilität.

B. Technische Daten
Z-ONE XS S M L
Fläche/Area/ Surface [m2]
23,80 25,96 29,38 32,08
Fläche projiziert 21,14 23,06 26,10 28,5
Spannweite/Span/ Envergure [m]
10,98 11,47 12,20 12,75
Streckung 5,07 5,07 5,07 5,07
Zellenzahl 40 40 40 40
Startgewicht 50-70 60-85 80-105 100-130
DHV Klasse 1GH 1GH 1GH 1GH
Gurtzeugbeschränkung (GH)
Wir weisen darauf hin, dass der Z-ONE ausschließlich in Kombination mit
einem Gurtzeug mit normalem Brustgurt ohne feste Kreuzverstrebung
zugelassen ist. Diese Gurtzeuge haben den entscheidenden Vorteil, dass sie
Pilot und Schirm als Einheit zusammenführen und ein präzises Fluggefühl
vermitteln.
ÜBERSICHTSZEICHNUNG

1 Dein FIREBIRD Gleitschirm
1.1 Qualitätskontrolle
Bevor der Gleitschirm unsere Firma verlässt, wird er von FIREBIRD
Fachleuten überprüft und vermessen. Bei einer eingehenden Qualitätskontrolle
werden serienmäßig Gurt- und Leinenlängen kontrolliert und entsprechen der
für dieses Gerät zugelassenen Norm. Jede nicht von uns empfohlene
Veränderung am Gerät schließt jegliche Haftung aus.
1.2 Überprüfen des Gerätes
Jeder Kunde sollte sich vor seinem ersten Flug mit dem neuen Gerät vertraut
machen.
Zur ordnungsgemäßen und richtigen Überprüfung eines Gleitschirms liegt die
Kappe mit dem Obersegel nach unten. Die Leinen werden an den Tragegurten
gespannt. Ihre systematische Anordnung ist übersichtlich, die A-Leinen sind
am A-Tragegurt befestigt, die B-Leinen am B-Tragegurt usw.. Die
Stammleinen sind durch kleine Schraubkarabiner, die per Handkraft
verschlossen werden, mit den Tragegurten verbunden.
Die Bremsleinen laufen durch Führungsrollen an die hinteren Tragegurte und
enden in den Bremsschlaufen.
Neben eigenverantwortlichen Routine-Checks empfiehlt es sich, den Schirm
nach besonders hohen Belastungen (Baumlandung ...), Veränderungen am
Flugverhalten oder anderen Auffälligkeiten gesondert zu kontrollieren.
Weiter ist es sinnvoll, nach Veränderungen irgendeiner Art den Schirm an
einem geeigneten Übungsgelände einzufliegen.
Zur regelmäßigen Überprüfung des Gleitschirms empfehlen wir folgende
Checksystematik:
- Beschädigte Nähte an Obersegel, Untersegel oder Zwischenwänden?
- Risse in Obersegel, Untersegel oder Zwischenkammern?
- Nähte und Leinenbefestigungen an der Kappe in Ordnung?
- Leinen frei und ohne Beschädigung?
- Bremsleinen frei und ohne Beschädigung, Bremsschlaufen richtig angebracht
und in Ordnung?
- Leinenschlösser verschlossen?
- Beschädigungen der Nähte an Gurtzeug oder Tragegurten?
Alle festgestellten Schäden am Gerät müssen umgehend behoben
werden. Größere Reparaturen müssen von FIREBIRD oder einem
FIREBIRD Vertrags-Händler durchgeführt werden.

1.3 Einstellung der Bremsleinen
Die Steuerleinen sind mehrfach verzweigt an der Hinterkante der Kappe
befestigt (Steuerspinne). Von dort laufen die Steuerleinen zu den hinteren
Tragegurten und durch die Führungsrollen zu den Bremsschlaufen.
Druckknöpfe an den hinteren Tragegurten dienen als Transportsicherung.
Die Bremsleinen werden ab Werk eingestellt und sind durch eine Markierung
gekennzeichnet. Mit dieser Einstellung wurde der Gleitschirm von unseren
Testpiloten geflogen. Sie dient als Ausgangsbasis für eine individuelle
Einstellung, die von Armlänge und Gurtzeug des Piloten abhängt. Wir
empfehlen, das Abstimmen der Bremsen an einem Übungsgelände
durchzuführen.
Folgende Punkte sind dabei zu beachten:
- jede Veränderung sollte in kleinen Schritten erfolgen (max. 5 cm)
- bei Verkürzung muss ein Spielraum von mind. 5cm eingehalten
werden, bevor die Hinterkante heruntergezogen wird, ebenso beim
Einsatz des Speedsystem
- der gesamte Bremsbereich muss erflogen werden können (offen bis
Strömungsabriss bei der Landung)
- die bevorzugt geflogene Bremsenstellung liegt im Idealfall auf
Schulterhöhe
- vom Wickeln der Bremsleine ist abzuraten (Rettungsgeräte-Einsatz,
Verschiebung des Stall-Punktes, Blutzirkulation)
Bei sämtlichen Veränderungen sollten die Bremsschlaufen und Steuerleinen
mit einem Spierenstichknoten verbunden werden.
Dieser Knoten löst sich unter Belastung nicht, kann jedoch bei Bedarf leicht
geöffnet werden.
Die korrekte Ausführung dieses Knotens beachten, da sonst die Gefahr
des Lösens besteht!
Die Bremsleine grundsätzlich so einstellen, dass bei offener Bremse die
Segelhinterkante nicht heruntergezogen wird (Sackflug- bzw.
Stallgefahr)!!!

2. Start
2.1 Wichtig – trockener Schirm
Voraussetzung für einen unbeschwerten Flug ist ein trockener Gleitschirm. Ein
durchnässter Gleitschirm hat sowohl veränderte Start/Lande- als auch
Flugeigenschaften. Sollte der Gleitschirm während des Fluges nass werden,
ist unverzüglich ein geeigneter Landeplatz anzufliegen. Starke
Steuerbewegungen sind zu vermeiden. Der verfügbare Steuerweg nimmt ab.
Sackfluggefahr, Erhöhung der Stallgeschwindigkeit!
2.2 Startvorbereitungen
Beim bogenförmigen Auslegen des Gleitschirms ist darauf zu achten, dass die
Eintrittsöffnungen nach oben zeigen und offen sind, die Segelmitte stellt den
höchsten Punkt (zum Berg) dar. Dadurch füllt sich die Kappe beim Aufziehen
des Schirms von der Mitte her und steigt gleichmäßig und stabil auf.
Das sorgfältige Sortieren der Leinen ist unter anderem Voraussetzung für
einen sicheren Start. Dazu werden zunächst die Leinen einer Seite durch
Anheben und leichtes Ziehen des jeweiligen Tragegurts auf Spannung
gebracht, ohne dabei die Position der Kappe zu verändern. Dabei liegt der
Tragegurt so, dass die A-Leinen bzw. der A-Tragegurt sich oben befinden, der
D-Tragegurt unten. So wird sachgemäß geprüft, ob Leinengruppen verdreht
oder ineinander geschlauft sind. Keine Leine darf mit einem Tragegurt oder
anderen Leinen verdreht sein. Die Bremsleine wird sorgfältig im Halbkreis
seitlich ausgelegt. Dabei ist auch die Bremsspinne zu überprüfen. Alle Leinen
müssen frei und sichtbar am Boden vor der Kappe liegen, Verhängungen und
Knotenbildung müssen ausgeschlossen werden!
Sollte sich die Lage der Kappe durch den Leinencheck verändert haben,
muss diese wieder richtig ausgelegt werden, die Eintrittskante beschreibt
einen Bogen. Sind diese Vorbereitungen abgeschlossen, müssen nach
Anlegen des Gurtzeugs die Verbindungen von Gurtzeug und Schirm
unbedingt überprüft werden. Die Verschlüsse müssen gesichert und das
Rettungssystem der Vorschrift entsprechend angebracht sein.
Bedingungen
Vor dem Start ist der allgemein gültige 5-Punkte Check gewissenhaft
durchzuführen.
2.3 Start-Check
1. Eintrittskante geöffnet und bogenförmig ausgelegt?
2. Sind Leinen und Bremsleinen frei?
3. Gurtzeug, Rettung, Karabiner und Helm überprüfen!
4. Erlauben Windrichtung und -stärke einen komplikationsfreien Start?
5. Ist der Luftraum in alle Richtungen frei?

2.4 Startverhalten
Firebird-Schirme haben ein ausgewogenes Startverhalten und benötigen keine
spezielle Starttechnik. Der Startvorgang wird mit gleichmäßigem Zug an den
A-Gurten eingeleitet. Bei konstanter Zugverteilung neigt der Schirm weder
zum hängen bleiben, noch zum überschießen.
Es ist zu beachten, dass die Tragegurte in dieser Phase nicht versehentlich
nach unten gezogen werden. Dies könnte zum Verschließen der
Eintrittsöffnungen führen. Befindet sich der Schirm über dem Piloten,
unterstützt ein dosiertes Anbremsen der Kappe (je nach Geländeneigung,
Windbedingungen, Anfangsimpuls von leicht bis stark) einen kontrollierten
Startvorgang. Hier findet der Kontrollblick statt. Anschließend beginnt die
Beschleunigungsphase bis hin zum sicheren Abheben.
Bei leichtem oder null Wind sollten sich die Leinen beim Startlauf erst nach
ein bis zwei Schritten straffen. Dadurch füllt sich der Schirm gleichmäßig und
kommt bei unverminderter Geschwindigkeit selbständig über den Piloten.
Bei zunehmendem Wind sollte die Hinterkante der Kappe etwas
zusammengerafft werden, wodurch sich die Spannweite in diesem Bereich
reduziert. Ein zu schnelles Aufsteigen der Kappe und starke Zugkräfte auf den
Piloten kann so verhindert werden. Firebird-Schirme bieten durch die geteilten
A-Gurte eine zusätzliche Hilfe zu einem besonders sanften Aufziehen der
Kappe. Indem der Pilot nur die dickeren A-Gurte führt, steigt der Schirm mit
einer verminderten Fläche und geringerem Widerstand hoch. Es muss darauf
geachtet werden, dass die Flügelenden vor der Beschleunigungsphase offen
sind.
Bei Starkwind ist bevorzugt ein Rückwärtsstart durchzuführen. Wir empfehlen
wenig erfahrenen Piloten, an einem flachen Übungshang die Technik des
Rückwärtsstarts zu sichern und sich mit dem Verhalten des Schirms vertraut
zu machen. Tipp: Um den Schirm bei starkem Wind besser am Boden halten
zu können, werden die C- oder D-Gurte gezogen.
Sollte der Schirm sich während oder nach dem Aufziehen seitlich versetzten,
so muss der Pilot die Kappe Richtung Zentrum dosiert unterlaufen. Erst dann
erfolgen evtl. notwendige Richtungsänderungen mit den Steuerleinen. Bricht
der Schirm beim Aufziehen unkontrolliert aus, muss unmittelbar ein
Startabbruch erfolgen.

2.5 Windenschlepp
Firebird-Schirme sind generell für den Betrieb an der Schleppwinde geeignet.
Zusätzlich kann auch der Firebird Schlepp-Support verwendet werden. Die
Montage und Verwendung des Schlepp-Support werden nachfolgend
beschrieben. Startvorbereitungen und Aufziehtechnik entsprechen den oben
aufgeführten.
Über die Besonderheiten des Windenschlepp sollte sich der Pilot bei dem
Windenfahrer und dem Fluglehrer informieren.
Windenschlepp ist in Deutschland nur mit gültigem Windenschleppschein
erlaubt.
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ein schlepptaugliches
Gurtzeug verwendet werden muss!
2.6 Firebird Schlepp-Support
Der Firebird Schlepp-Support bietet für den Windenschlepp mehrere Vorteile:
Die Zugkraft des Schleppseiles wird direkt in die Tragegurte eingeleitet. Die
Schleppklinke kann mit dem Viereckschäckel einfach verbunden werden.
Der Schlepp-Support erhöht die Leistung während des Schleppvorgangs um
ca.10-15%.
Der beim Schleppvorgang verursachte höhere Anstellwinkel wird mit dem
Einsatz des Schlepp-Support kompensiert.
Montage des Schlepp-Support:
Die Montage des Schlepp-Support ist einfach und schnell:
Beschleunigerleine
Dreieckschäckel
Viereckschäckel
Öse
1. Tragegurt in Öse des Schlepp-Support stecken
2. Dreieckschäckel in Beschleunigerleine einhängen

3. Tragegurt und Schlepp-Support zusammen in Gurtzeugkarabiner
einhängen
4. Schlepp-Klinke mit Viereckschäckel verbinden
Unbedingt beachten:
Der Tragegurt und der Schlepp-Support müssen im Gurtzeugkarabiner
eingehängt sein. Die Verbindung Dreieckschäckel/Beschleunigerleine darf vor
Schleppbeginn (im Normalflug) nicht unter Zug sein. Gegebenenfalls die
Verbindung mit einer Leine oder einem Schäckel verlängern.
Funktionsweise:
Schirm wird
beschleuni
g
t
Verbindung Schlepp-
Support/Beschleunigerleine
Verbindung
Schleppklinke Gurtzeug-
Karabiner
Durch den Zug an Schleppseil/Schleppklinke wird der Gleitschirm
beschleunigt. Achtung: Ist während der Aufziehphase das Schleppseil schon
unter Zug, wird der Schirm bereits beschleunigt und muss dann eventuell im
Scheitelpunkt angebremst werden.

3 Flugtechnik
3.1 Geradeausflug/Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit des Gleitschirms wird durch beidseitiges Herabziehen der
Brems- bzw. Steuerleinen reguliert. Je weiter dabei gezogen wird, desto
langsamer wird der Gleitschirm. Eine Übersicht über das Verhalten des
Gleitschirms in verschiedenen Bremsgraden führt folgende Skizze auf. Die
Position der Arme ist als Beispiel zu sehen und ist abhängig vom Gerätetyp
(Steuerweg bis zum Strömungsabriss(100%)), Gurtzeug (Höhe der
Karabineraufhängung) und persönlicher Bremsleineneinstellung. Die
Bremsstellungen (z.B. für geringstes Sinken) sollen ebenfalls nur als
Anhaltspunkt dienen und sind vom Gerätetyp abhängig.
0% = Bremsen ganz oben
Hände ganz oben, Bremsleinen hängen leicht durch: de
r
Gleitschirm fliegt mit maximaler Geschwindigkeit, die je
nach Flächenbelastung (Pilotengewicht und Größe des
Gleitschirms) differenziert.
25% = leichtes Anbremsen
Bremsen in Gesichtshöhe: Geschwindigkeits-
Ä
nderung in Relation zur deutlich verringerten
Sinkrate klein.
30-40% = mäßiges Anbremsen
Bremsen in Brusthöhe: der Gleitschirm fliegt mit
geringstem Sinken.
100%= maximale Bremsstellung
Bremsen etwa in Bauchhöhe: der Gleitschirm fliegt mit
minimaler Geschwindigkeit, die Sinkrate nimmt stark zu und
Fahrtgeräusche sind kaum noch hörbar. Gefahr des totalen
Strömungsabrisses.

3.2 Speedsystem
Das Speedsystem erweitert den
Geschwindigkeitsbereich des
Gleitschirms deutlich. Es wird über
einen Fußstrecker aktiviert und
beschleunigt den Schirm durch eine
Verkleinerung des Anstellwinkels.
Bei stärkerem Gegenwind ist der
Einsatz des
Beschleunigungssystems sehr
vorteilhaft und effektiv. Beim
beschleunigten Flug treten
Störungen (Einklapper, Frontstall)
dynamischer auf, in diesem Fall ist
der Beschleuniger unverzüglich in
Ausgangsstellung zurück zu führen.
Die Kappe ist anfälliger auf
auftretende Turbulenzen, was nicht
zu unterschätzen ist! Für den
Einsatz des Speedsystems ist
ausreichend Bodenabstand
Voraussetzung (s. Kapitel „Aktives
Fliegen“).
Trimflug Beschleunigter Flug
3.3 Kurvenflug
Beim Kurvenflug reagiert der Gleitschirm direkt auf Impulse des Piloten und
lässt sich einfach steuern.
Um eine Kurve zu Fliegen, wird die Bremse der geplanten Kurveninnenseite
gezogen. Die Geschwindigkeit der Kurve hängt vom Bremsgrad der zweiten
Bremse (Kurvenaußenseite) ab. Auch Fluggeschwindigkeit beim Einleiten und
Neigung der Kappe, die durch verschieden starkes Bremsen verändert wird,
bestimmen den Kurvenradius. Zur näheren Erläuterung folgende Einteilung:
Kurve aus voller Fahrt
Wird nur eine Steuerleine gezogen, fliegt der Schirm eine weite Kurve mit
großem Radius und relativ starker Querneigung (Zentrifugalkraft). Er verliert
dabei relativ viel Höhe. Je tiefer die Leine gezogen wird, desto enger wird die
Kurve und desto größer werden Querneigung und Höhenverlust.
Leicht angebremste Kurve
Zieht man bei etwa 30% gezogenen Steuerleinen die Bremsleine der
Kurveninnenseite noch tiefer, kurvt der Schirm extrem eng. Durch die geringe
Querneigung der Kappe ist der Höhenverlust kleiner als bei hoher
Geschwindigkeit. Bei dieser eng gehaltenen Kurventechnik zeichnet sich der
Gleitschirm durch sehr gute Sinkraten aus. Eine Kombination aus Bremsaktion
und Gewichtsverlagerung (ohne dabei eine Verformung der Kappe zu

verursachen) bildet die effektivste Methode beim Thermikflug. Weiter kann
geringes Kurvensinken durch einseitiges Bremsen bei gleichzeitiger Gewichts-
Verlagerung zur Kurvenaußenseite erreicht werden.
Stark angebremste Kurve
Zieht man bei etwa 75% gezogenen Steuerleinen die Leine der
Kurveninnenseite noch tiefer, reagiert der Schirm extrem schnell, dreht flach
und bleibt bei geringer Fahrt fast ohne Querneigung. Das Steuergefühl ist
weich. VORSICHT! Es kann dabei zum Strömungsabriss/Trudeln
kommen. Beim Herabziehen der kurveninneren Steuerleine ist zu empfehlen,
die äußere Leine entsprechend nachzulassen.
Steilspirale
Siehe Kapitel Abstiegshilfen.
Wing Over
Wing Overs sind enge, mit starker Schräglage geflogene S-Kurven. Man sollte
keine Kappenschräglage über 45° erfliegen, da es im Extremfall zu großen
asymmetrischen Einklappern führen kann.
VORSICHT: Wing Overs dürfen nur in ausreichender Höhe geflogen
werden!!!
3.4 Aktives Fliegen
Aktives Fliegen bedeutet, Veränderungen an der Kappe im Flug durch
geeignete Brems- und Körperbewegungen so entgegenzuwirken, dass sich
der Pilot immer zentral unter dem Schirm befindet. Das setzt Flugerfahrung
voraus, verhindert aber in turbulenter Luft Störungen wie Einklapper o.ä. und
ist die sicherste Methode, ein stabiles Flugverhalten bei optimaler Leistung zu
erreichen.
Beispiel: Fliegt ein Pilot in einen Thermikbart ein, so wird der Gleitschirm
abgebremst und die Kappe nickt nach hinten. In diesem Fall sollte der „aktive
Pilot“ die Bremsen lösen, um dem Gleitsegel wieder Vorwärtsfahrt zu geben.
Genau umgekehrt verhält es sich beim Verlassen der Thermik, der Schirm
wird angebremst und einem Vorschnellen vorgebeugt.
Beim Fliegen in Turbulenzen kann der Pilot die Anstellwinkelveränderung über
den Bremsdruck erfühlen und entsprechend reagieren. Der Bremsdruck sollte
immer konstant gehalten werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass
das Gerät nicht übersteuert oder zu stark angebremst wird.
Tritt hingegen beim Einsatz des Speedsystem eine Entlastung des
Fußstreckers auf, kündigt sich wahrscheinlich ein Einklapper an und der Pilot
muss sofort den Beschleuniger nachlassen.
Schrittweise sollte man sich mit den Vorteilen des Aktiven Fliegens vertraut
machen. Tipp: Eine unterstützende Übung zum aktiven Fliegen ist „das
Spielen“ mit dem Schirm bei stärkerem Wind. Ohne Blickkontakt zur Kappe
versucht der Pilot, den Schirm zentral über sich zu halten ohne dabei
abzuheben.
3.5 Landung

Bei der Landung verhält sich der Gleitschirm dank seines unkomplizierten
Flugverhaltens sehr angenehm. Die Landeeinteilung soll so geplant werden,
dass genügend Höhe für einen gegen den Wind gerichteten Endanflug bleibt.
Das Gerät ist zu stabilisieren um nach rechtzeitigem Aufrichten im Gurtzeug
den Landevorgang konzentriert durchführen zu können. Die Bremsen werden
bis über den Stallpunkt zügig und konsequent durchgezogen und der Pilot
wird sanft Aufsetzen.
Sollte wider Erwarten Rückenwind herrschen, muss etwas früher über dem
Boden zur Landung angesetzt werden. Bei Starkwind ist sehr dosiert zu
bremsen. Der Schirm sollte unmittelbar nach der Landung kontrolliert aus dem
Wind genommen werden. Dabei ist zu beachten, dass der Schirm nicht unter
Druck mit den Eintrittsöffnungen voran auf den Boden fällt, um
Beschädigungen zu vermeiden. Nach der Landung gleich aushängen!
4 Abstiegshilfen
Im Flugsport sind Situationen durch plötzlich auftretende
Wetterverschlechterung oder Pilotenfehler nicht auszuschließen. Der Pilot ist
dann genötigt, möglichst viel Höhe in kurzer Zeit abzubauen. Auf die
verschiedenen Möglichkeiten des Schnellabstieges sollte sich jeder Pilot
vorbereiten, um richtig und schnell reagieren zu können. Die nun
angesprochenen Flugmanöver sollten beherrscht und unter Anweisung
trainiert werden. Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass es sich um
Notabstiegshilfen handelt und die Materialbelastung hoch ist.
4.1 Steilspirale
Diese Flugfigur bildet die effektivste Form des Schnellabstiegs, wobei die
Sinkgeschwindigkeit bei Gleitschirmen leicht über 14 m/s erreichen kann.
Zur Einleitung der Steilspirale wird auf einer Seite die Bremse kontinuierlich
herabgezogen bei gleichzeitiger Verlagerung des Körpergewichts. Beim
Einleiten nicht ruckartig vorgehen, Trudelgefahr. In diesem Fall sofort durch
Freigabe der Bremse den Vorgang abbrechen! Um den Außenflügel stabil
zu halten und die Sinkgeschwindigkeit während der Steilspirale zu
kontrollieren, sollte die Kurvenaußenseite leicht angebremst werden.
Das harmonische Ausleiten aus der Steilspirale erfolgt durch langsame
Freigabe der inneren Bremsleine und bedachtes Bremsen der
Kurvenaußenseite. Die Spirale sollte über mehrere Kreise sanft ausgeleitet
werden. Der Pilot darf keine hektischen Steuerbewegungen durchführen. Der
Schirm könnte im Extremfall seine hohe Geschwindigkeit unkoordiniert in
Höhe umsetzen. Seitliche Einklapper oder gar ein „Looping“ wären die Folge.
Das Ausleiten der Spirale wird bei Bedarf durch Verlagerung des
Körpergewichts zur Kurvenaußenseite unterstützt.

VORSICHT: Gleitschirme tendieren bei Sinkgeschwindigkeiten über 14
m/s generell zum Nachdrehen oder Verbleiben in der Steilspirale.
Unbedingt auf ausreichend Höhe achten!!!
Ein langsames Herantasten an dieses Extremflugmanöver sollte
stattfinden, da der enorme Höhenverlust (bis zu 80m pro Umdrehung)
und die starke Belastung auf den Körper des Piloten
gewöhnungsbedürftig sind.
Tipp: Beim Spiralen ist es vorzuziehen, den Blick auf einen Punkt am Boden
zu fixieren. Der Luftraum bleibt überschaubar und eventueller Übelkeit wird
vorgebeugt.
4.2 B-Stall
Einen schnellen und problemlosen Abstieg garantiert der B-Leinen-Stall. Es
können Sinkgeschwindigkeiten bis 8 m/s erreicht werden. Durch gleichzeitiges
Ziehen der B-Tragegurte (rote Leinen) wird ein Bauch in die Profilunterseite
gezogen, was zum Strömungsabriss und leichtem rückwärtigen Abkippen der
Kappe führt. Um den B-Stall einzuleiten, umgreift der Pilot am besten die
Karabiner oberhalb des B-Tragegurtes (s. Skizze Tragegurte) und zieht sie
gleichmäßig herunter. Der Kraftaufwand ist zu Beginn relativ hoch, lässt aber
mit zunehmendem Weg nach. Der Schirm schiebt sich in Profilrichtung
zusammen. Durch weiteres Herunterziehen der B-Gurte kann die
Sinkgeschwindigkeit erhöht werden. Dabei dürfen jedoch weder der A- noch
der C-Gurt mitgezogen werden, da sonst eine instabile Fluglage auftritt. Sollte
dennoch der Pilot in diese Situation geraten, so kann er durch Loslassen der
B-Gurte dieses Problem beheben.
Beim Ausleiten des B-Leinen-Stalls ist darauf zu achten, dass die Gurte zügig
und symmetrisch freigegeben werden. Der Schirm nickt leicht nach vorne und
nimmt Fahrt auf. Beim Firebird-Gleitschirmen besteht auch bei langsamer
Freigabe der B-Gurte keine Sackflug-Tendenz. Dennoch sollte einige
Sekunden abgewartet werden, bis wieder Steuerbewegungen ausgeführt
werden.
Sollten unerwartete Einflüsse dennoch einen Sackflug verursachen, so ist
dieser durch beidseitiges Drücken gegen die A-Gurte auszuleiten (s.
Extremflugmanöver „Sackflug“).

4.3 Ohren anlegen
Bei Firebird-Gleitschirmen ist das Ohrenanlegen mit Hilfe des geteilten A-
Gurtes besonders einfach durchzuführen. Beim Herunterziehen der dünnen
A´-Gurte klappen die Flügelenden ein. Die Sinkgeschwindigkeit erreicht 2-3
m/s, die Horizontalgeschwindigkeit verändert sich nur geringfügig. Der
zusätzliche Einsatz des Speedsystem erhöht beide Werte. Durch Nachfassen
der äußersten A-Leine kann die tragende Fläche weiter verringert werden.
Hierbei sollte unbedingt das Speedsystem mit eingesetzt werden. Der Schirm
ist bei diesem Flugmanöver durch Gewichtsverlagerung voll steuerbar. Die
Belastung nimmt auf der verbleibenden Fläche zu und der Schirm befindet
sich in einem stabileren Flugzustand. Um ein Überbelasten des Schirmes
auszuschließen, darf keine zusätzliche Steilspirale geflogen werden. Zur
Ausleitung einfach die Gurte, bzw. Leinen wieder freigeben und
gegebenenfalls noch eingeklappte Bereiche durch kurzen Bremsimpuls öffnen.
Achtung: durch die angelegten Ohren, erfährt der Gleitschirm eine
Anstellwinkelvergrößerung. Entsprechend dosiert sollten daher die
Bremsleinen eingesetzt werden – Sackfluggefahr.
5. Extremflugmanöver
Bei der Entwicklung unserer Schirme legen wir besonders großen Wert auf
Stabilität der Kappe und unkompliziertes Handling. Um eine Zulassung zu
erhalten, wird der Musterschirm in einem Testverfahren geprüft. Dabei werden
verschiedene Extremflugzustände eingeleitet und je nach Schirmreaktion
bewertet. Diverse Bewertungskriterien (z.B. Dynamik, Wegdrehverhalten,
Steuerweg) bestimmen die Einteilung in eine Kategorie. Je niedriger die die
Einteilung ist, desto mehr Spielraum bleibt für Pilotenfehler.
Es sollte dem Piloten bewusst sein, das das Prüfverfahren nicht alle möglichen
meteorologischen Zustände abdecken kann und um vergleichbare Ergebnisse
zu erhalten in möglichst ruhigen Bedingen durchgeführt wird.
Unkontrollierte Fluglagen, verursacht durch meteorologische Verhältnisse oder
schwerwiegende Pilotenfehler, sind jedoch nicht auszuschließen. Auf solche
Situationen sollte jeder Pilot vorbereitet sein und nach entsprechender
Reaktion den Flug sicher fortsetzen können. Dazu empfehlen wir die
Teilnahme an einem Sicherheitstraining.
5.1 Einklapper
Einklapper behebt der Gleitschirm in der Regel von selber, dennoch sollte der
Pilot durch gezieltes Eingreifen den Übergang in den Normalflug unterstützen,
was meistens ohne großen Aufwand möglich ist. Durch „Aktives Fliegen“
werden Einklapper meist im Vorfeld verhindert.
Frontale Einklapper

ergeben sich beispielsweise dann, wenn der Schirm unangebremst eine
Thermik verlässt. Die Wiederöffnung kann durch sanftes Betätigen beider
Bremsen schneller herbeigeführt werden. Sollte der Schirm öffnen, wenn er
sich hinter dem Piloten befindet, ist mit einem verstärkten Vorschießen zu
rechnen, das mit gezieltem Bremseinsatz abzufangen ist.
Seitliche Einklapper
Sollte in turbulenter Luft eine Seite des Gleitschirms einklappen, muss der
Pilot die offene Seite gefühlvoll anbremsen („gegensteuern“), um ein
Wegdrehen zu verhindern. Steuerweg und Steuerdruck werden im Vergleich
zum Normalflug weniger. Die eingeklappte Seite wird durch einen kurzen
energischen Zug der Bremsleine geöffnet. Sollte der Schirm nicht gleich
reagieren, muss der Vorgang wiederholt werden. Auf Bodenabstand achten!
Einklapper mit Verhänger
In seltenen Fällen kann es bei einem Einklapper zu Verhängern kommen, z.B.
nach verkehrt ausgeleiteten Extremflugmanövern. Hier muss sofort die
Drehbewegung mit Gegensteuern gestoppt werden, da sehr schnell eine
starke Rotation einsetzen kann, die immens hohe Steuerkräfte zur Folge hat.
Ist die Rotation beendet, kann versucht werden, den verhängten Teil
einzuklappen oder die Stabi-Leine einzuholen bis der Verhänger sich löst.
Führt dies nicht zum Erfolg und ist der Schirm nicht manövrierfähig oder ist
nicht mehr genügend Bodenabstand vorhanden, muss die Rettung ausgelöst
werden! Sehr erfahrenen Piloten bietet sich bei ausreichender Höhenreserve
der Fullstall als weitere Möglichkeit an. Der Schirm wird von hinten angeströmt
und die Leinen lösen sich.
5.2 Sackflug
Alle Gleitschirme werden vom DHV auf ihr Verhalten nach einem Sackflug
getestet und gehen selbständig wieder in den Normalflug über. Erkennbar ist
der Sackflug daran, dass der Schirm mit geöffneter Kappe nahezu ohne
Vorwärtsbewegung nach unten „sackt“.
Sollte der Schirm beispielsweise bei extremen Turbulenzen oder nach
Extremflugmanövern in den Sackflug geraten und ihn nicht ohne Dazutun des
Piloten beenden, kann der Schirm durch Drücken der A-Tragegurte in
Flugrichtung (dazu kurz unterhalb der Leinenschlösser greifen) Fahrt
aufnehmen, deutliche Fahrtgeräusche sind hörbar. Auf gar keinen Fall darf ein
Sackflug in Bodennähe ausgeleitet werden, da der Schirm Fahrt aufnimmt und
der Pilot hinterher pendelt. Hier sollte sich der Pilot sofort im Gurtzeug
aufrichten und die Landefalltechnik anwenden.
Das Betätigen der Bremsen ist im Sackflug zu unterlassen: Trudel- und
Stallgefahr!
5.3 Fullstall

Der Gleitschirmflieger erlebt bei fast jedem seiner Flüge einen dynamischen
Stall, und zwar bei der Landung. Die Kappe leert sich abrupt und kippt nach
hinten weg: ein Strömungsabriss liegt vor.
Der Fullstall gehört zu den gefährlichen Flugmanövern, die nicht bewusst
herbeigeführt werden sollen.
Kippt die Kappe nach einem fehlerhaften Bremsmanöver (längeres Anhalten
der Bremsen über 100%) oder bei stark angezogener Bremse und
gleichzeitigem Aufstellen des Schirmes in Turbulenzen nach hinten weg, darf
der Pilot nicht vor Schreck die Bremsen sofort auslassen. Erst wenn sich die
Kappe wieder über dem Piloten stabilisiert hat, werden die Bremsen langsam
vollständig freigegeben, so dass eine Vorwärtsbewegung der Kappe möglich
ist. Dabei kann es zu Einklappern kommen.
5.4 Trudeln
Trudeln wird verursacht, wenn eine Steuerleine voll durchgezogen oder im
Langsamflug eine Seite zusätzlich stark angebremst wird. Die Drehachse
wandert in das Zentrum der Kappe. Der Schirm gerät in eine Negativkurve, die
beim Gleitschirm durch sofortiges Nachgeben der Bremsleine in der
Kurveninnenseite behoben werden kann.
Bei andauerndem Trudeln müssen beide Bremsen dosiert vollständig
freigegeben werden. Dieses gefährliche Flugmanöver nicht mit Absicht
erfliegen! Sollte der Pilot überfordert sein, den Vorgang abzubrechen oder
gerät der Schirm aus einem anderen Grund wie Leinenüberwurf oder
ähnliches außer Kontrolle, ist unverzüglich das Rettungssystem zu aktivieren!
5.5 Bremsenausfall
Sollte es dazu kommen, dass der Pilot den Bremsgriff nicht betätigen kann
(Beschädigung, Verknoten, Bremsleinenriss), so ist der Gleitschirm trotzdem
sicher zu steuern. Dafür bedient sich der Pilot der D-Tragegurte, die auf der
entsprechenden Seite heruntergezogen werden und steuert ohne großartige
Flugmanöver den Landeplatz an. Vorsicht: Steuerdruck und Steuerweg
differieren zur normalen Bremse.
5.6 Motorisiertes Fliegen
Firebird-Gleitschirme sind für den Einsatz im motorisierten Betrieb gut
geeignet, Start- und Flugverhalten sind einfach zu handeln.
Im Vorfeld ist eine gesonderte Zulassung beim DULV einzuholen, die
Luftrechtlichen Vorschriften sind zu beachten.
Um sichere und erfolgreiche Flüge mit einem Rucksackmotor zu
gewährleisten, ist eine fachspezifische Ausbildung zu absolvieren. Eine
zugelassene Ausrüstung ist Voraussetzung.
Table of contents
Other FireBird Aircraft manuals
Popular Aircraft manuals by other brands

AEROPRAKT
AEROPRAKT AEROPRAKT-32 Pilot operating handbook

DG Flugzeugbau
DG Flugzeugbau DG-1001M Flight manual
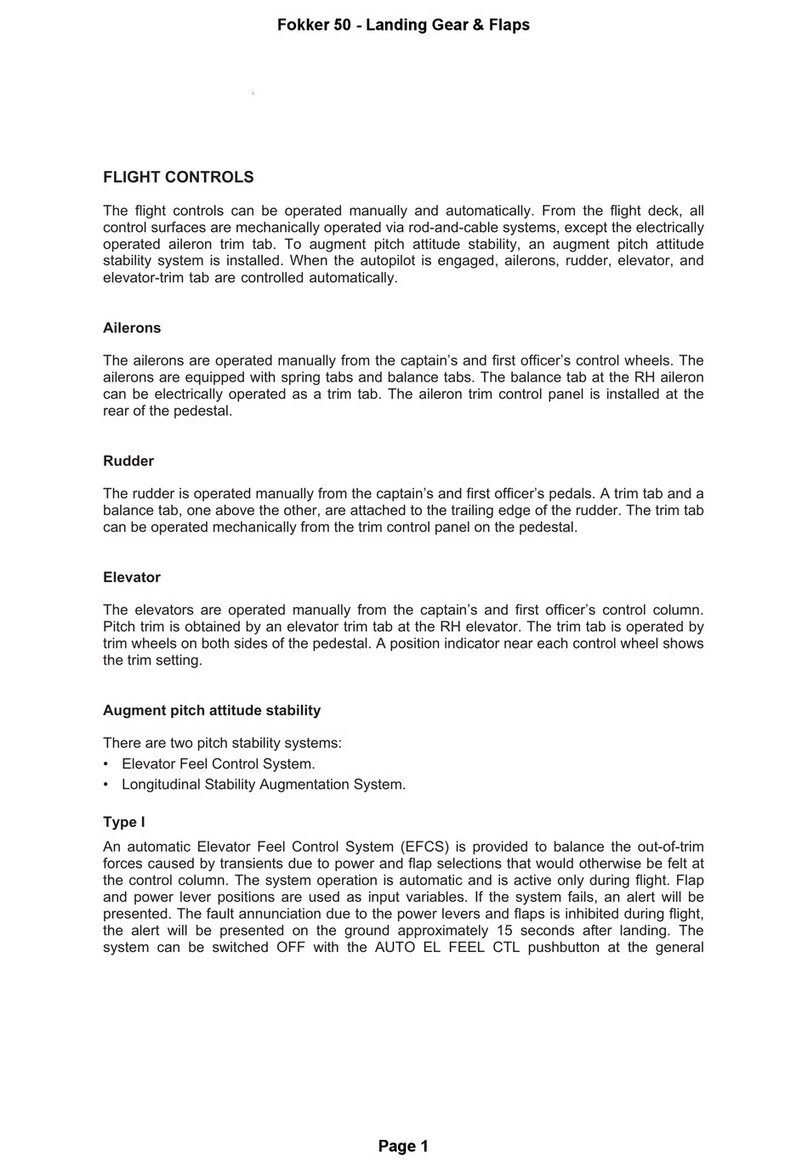
SmartCockpit
SmartCockpit Fokker 50 manual

Sportine Aviacija
Sportine Aviacija LAK-17C FES Flight manual

Wills Wing
Wills Wing RamAir 154 Owner's service manual

EADS Socata
EADS Socata TB 20 Pilot's information manual