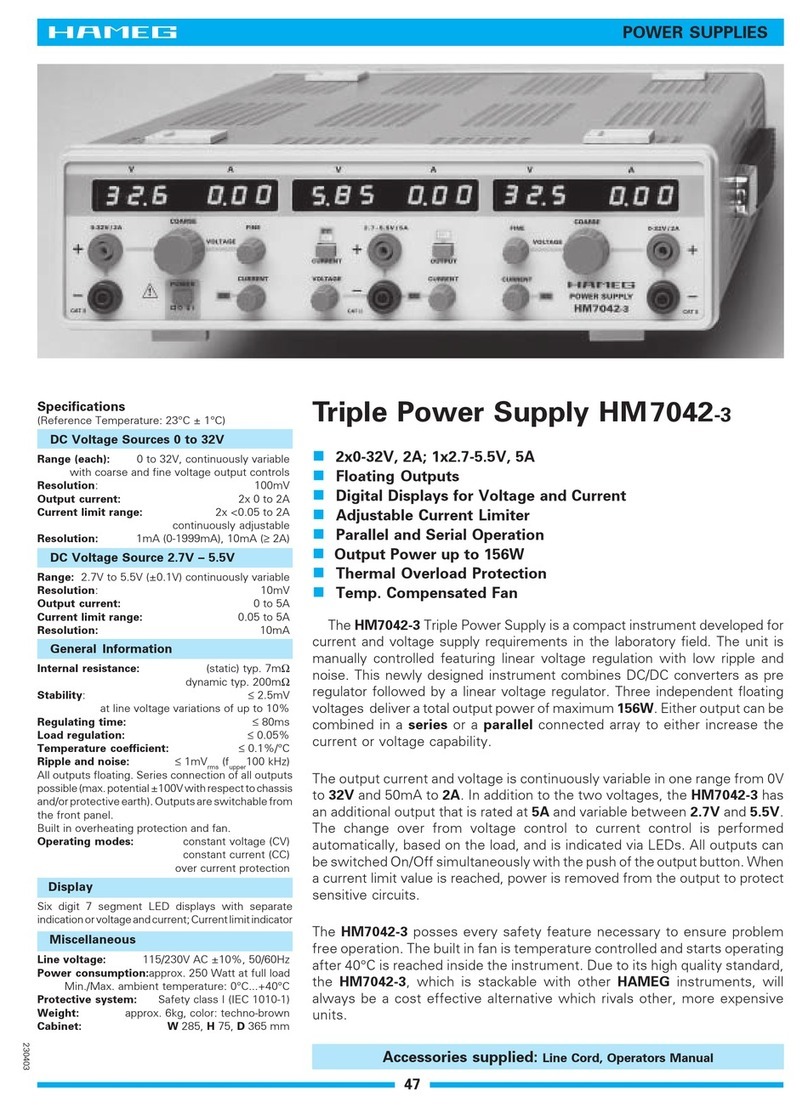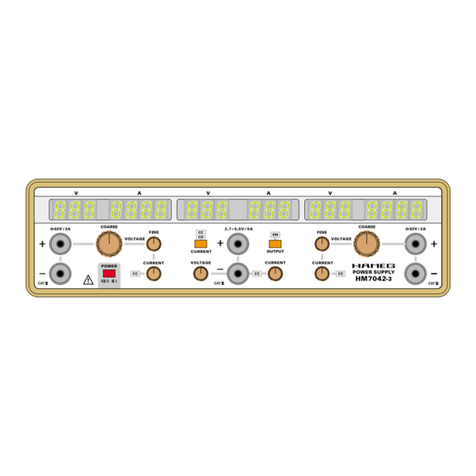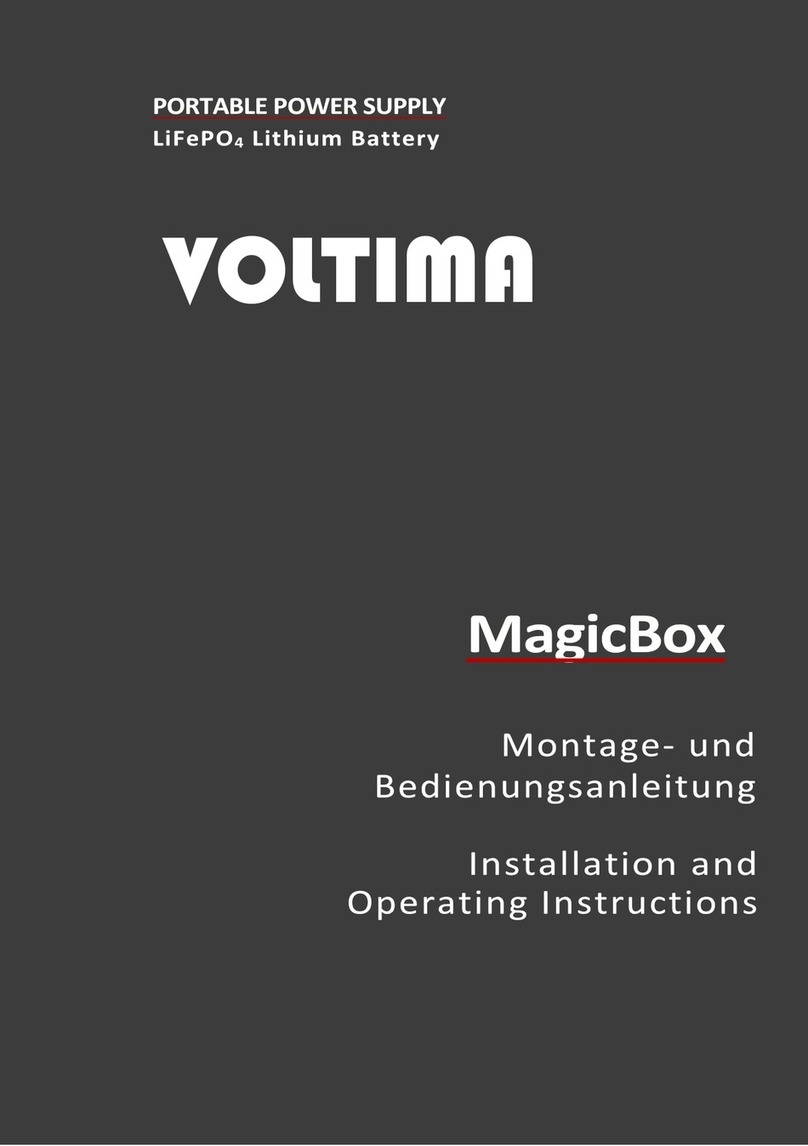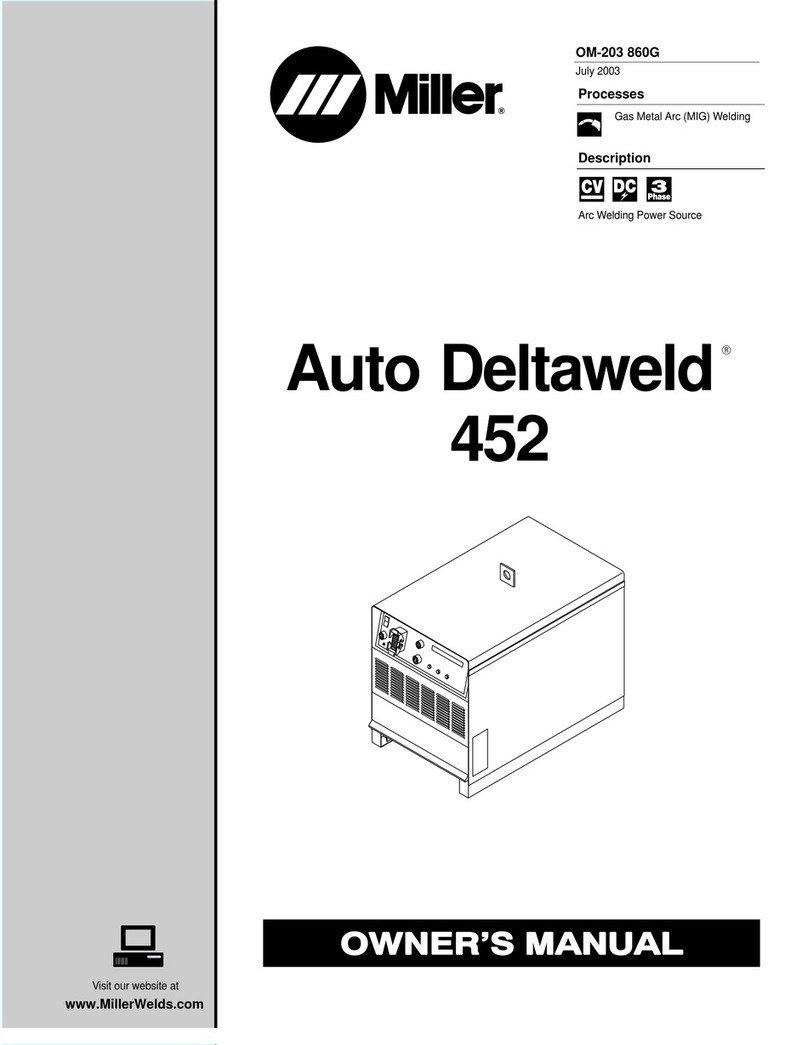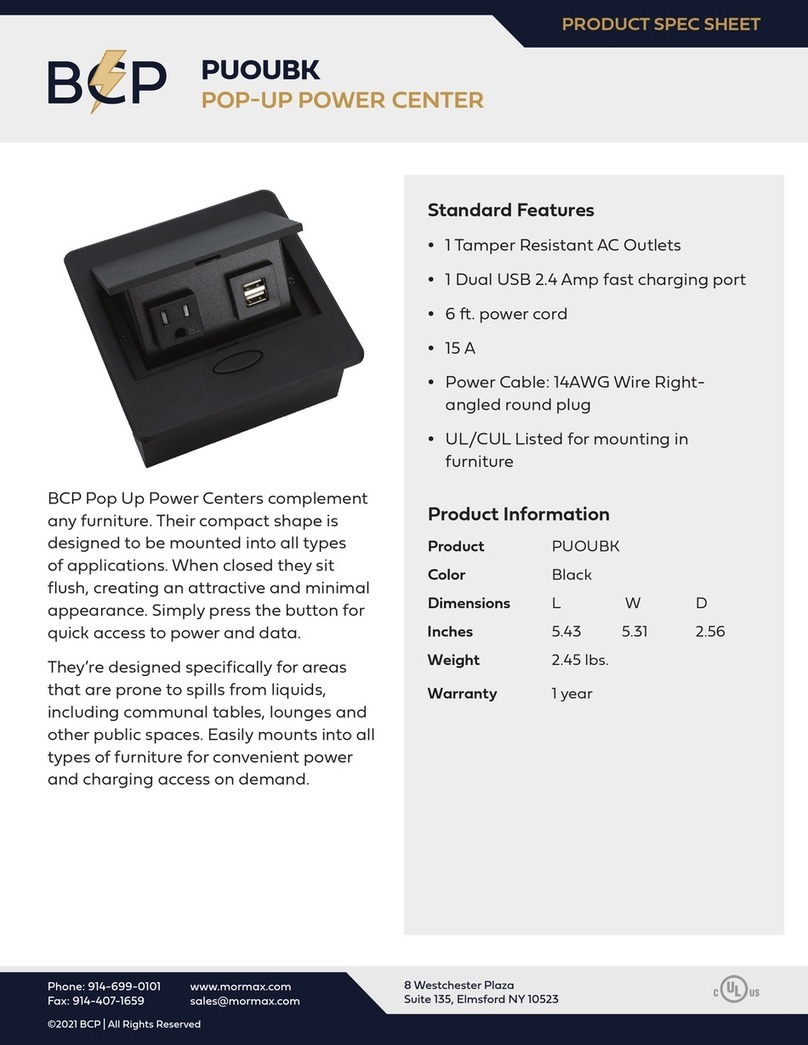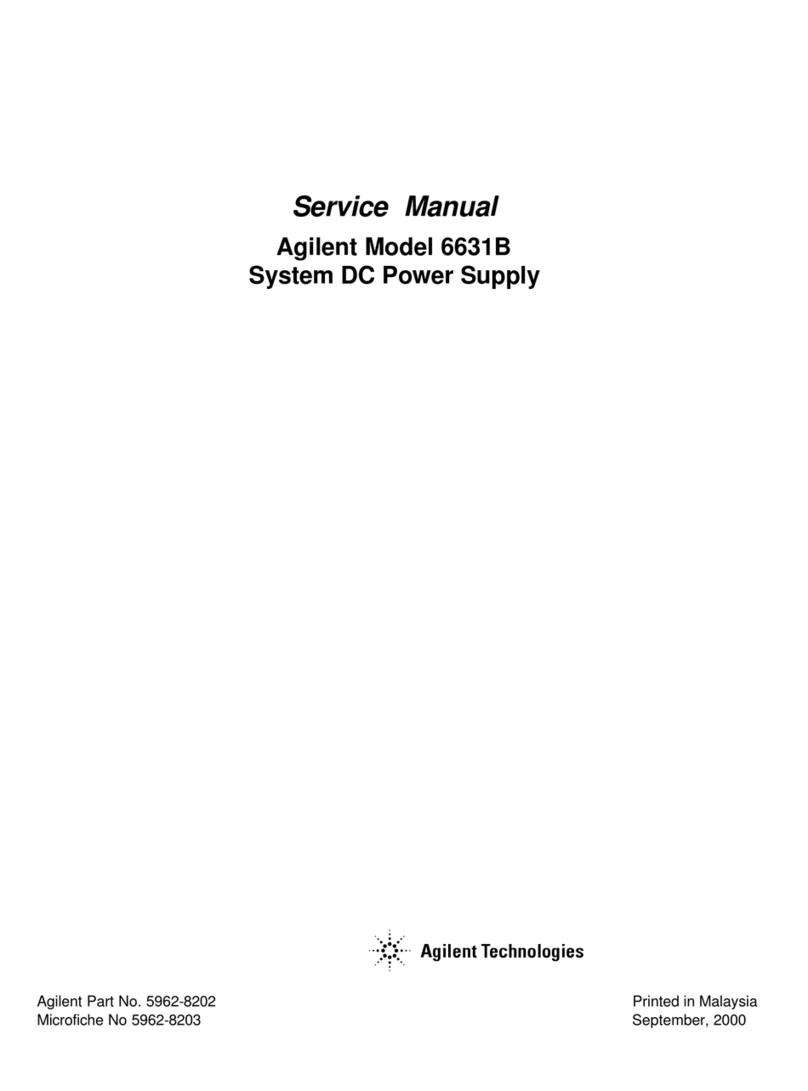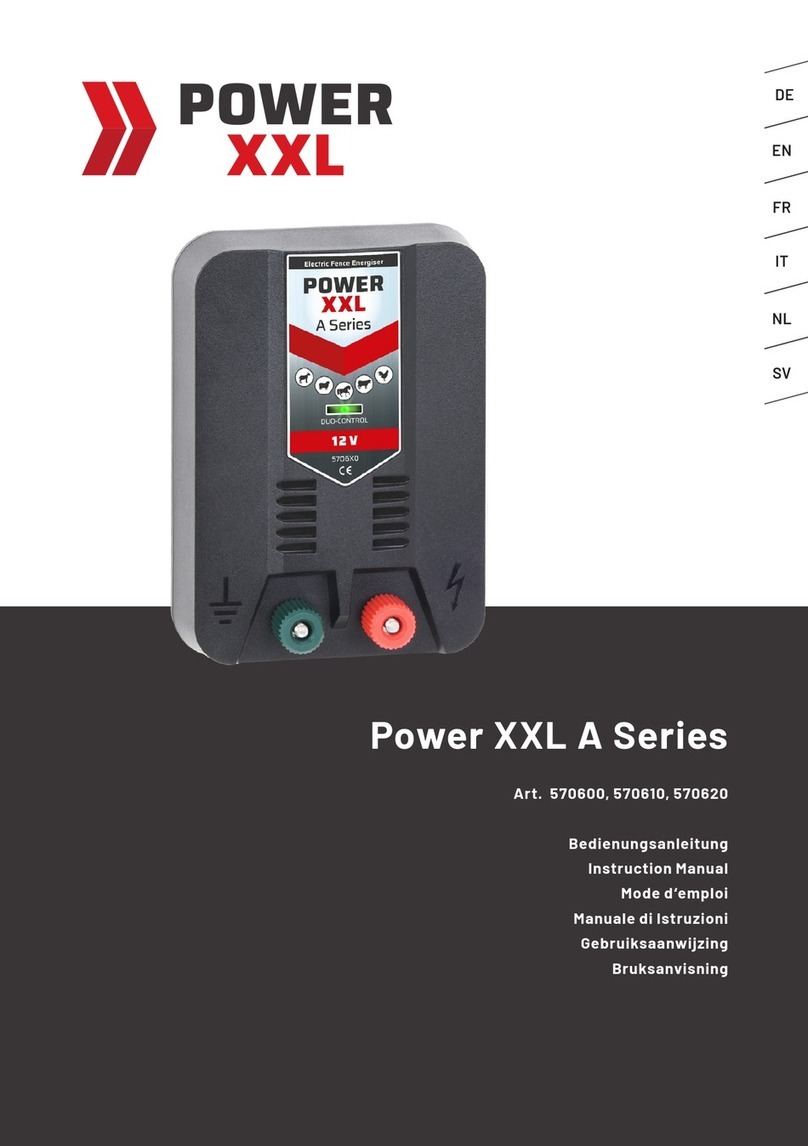2Änderungen vorbehalten
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung Inhalt
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie.
Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen
Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, wo
unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die
härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung
werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie
für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit
nden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.
Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und
Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen
Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind
jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen
Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit
folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:
1. Datenleitungen
Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit
externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend
abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung
nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen
Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge
von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden
befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer
Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen
sein.
Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes
Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von HAMEG
beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.
2. Signalleitungen
Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und
Messgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden.
Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen
(Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht
erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden benden.
Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen
(Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Massever-
bindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen
doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet
werden.
3. Auswirkungen auf die Geräte
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder
magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die
angeschlossenen Kabel und Leitungen zu Einspeisung unerwünschter
Signalanteile in das Gerät kommen. Dies führt bei HAMEG Geräten
nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung. Geringfügige
Abweichungen der Anzeige – und Messwerte über die vorgegebenen
Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in
Einzelfällen jedoch auftreten.
HAMEG Instruments GmbH
2Änderungen vorbehalten
0.1 Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeich-
nung
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei
der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw.
Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, in denen unterschiedliche
Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüf bedingun-
gen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für
den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt
(Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit nden die für den Industrie-
bereich geltenden Grenzwerte Anwendung.
Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Daten-
leitungen beeinussen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in
erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach
Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind
daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise
und Randbedingungen unbedingt zu beachten:
1. Datenleitungen
Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit exter-
nen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend
abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung
nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen
Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge
von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden
befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer
Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen
sein. Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes
Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von HAMEG
beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.
2. Signalleitungen
Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Mess-
gerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine
geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/
Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen
und sich nicht außerhalb von Gebäuden benden.Alle Signalleitungen
sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel-RG58/U)
zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge
getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte
Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.
3. Auswirkungen auf die Messgeräte
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magne-tischer
Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaus über die angeschlossenen
Messkabel zu Einspeisung unerwünschter Signalteile in das Messgerät
kommen. Dies führt bei HAMEG Messgeräten nicht zu einer Zerstörung
oder Außerbetriebsetzung des Messgerätes.Geringfügige Abweichungen
des Messwertes über die vorgegebenen Spezikationen hinaus können
durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.
4. Störfestigkeit von Oszilloskopen
4.1 Elektromagnetisches HF-Feld
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer
Felder können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des
Messsignals sichtbar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über
das Versorgungsnetz, Mess- und Steuerleitungen und/oder durch direkte
Einstrahlung erfolgen. Sowohl das Messobjekt, als auch das Oszilloskop
können hiervon betroffen sein.
Die direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung
durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen. Da die
Bandbreite jeder Messverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite
des Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar werden, deren
Frequenz wesentlich höher als die –3dB Messbandbreite ist.
4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität
Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten
Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv)
über Mess- und Steuerleitungen, ist es möglich, dass dadurch die
Triggerung ausgelöst wird. Das Auslösen der Triggerung kann auch
durch eine direkte bzw. indirekte statische Entladung (ESD) erfolgen.
Da die Signaldarstellung und Triggerung durch das Oszilloskop auch mit
geringen Signalamplituden (<500µV) erfolgen soll, lässt sich das Auslösen
der Triggerung durch derartige Signale (> 1kV) und ihre gleichzeitige
Darstellung nicht vermeiden.
HAMEG Instruments GmbH
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
2004/108/EG;
2006/95/EG
DIN EN 61010-1; VDE 0411-1: 08/2002
DIN EN 61000-6-3: 09/2007 (IEC/CISPR22, Klasse / Class / Classe / classe B)
VDE 0839-6-3: 04/2007
DIN EN 61000-6-2; VDE 0839-6-2: 03/2006
DIN EN 61000-3-2; VDE 0838-2: 06/2009
DIN EN 61000-3-3; VDE 0838-3: 06/2009
Bezeichnung / Product name / Programmierbares 2/3-Kanal-Netzgerät
Designation / Descripción: Programmable 2/3 channel Power Supply
Alimentation programmable de 2/3 voies
Fuente de Alimentación Programable
de 2/3 canales
Typ / Type / Type / Tipo: HMP2020, HMP2030
mit / with / avec / con: HO720
Optionen / Options /
Options / Opciónes: HO730, HO740