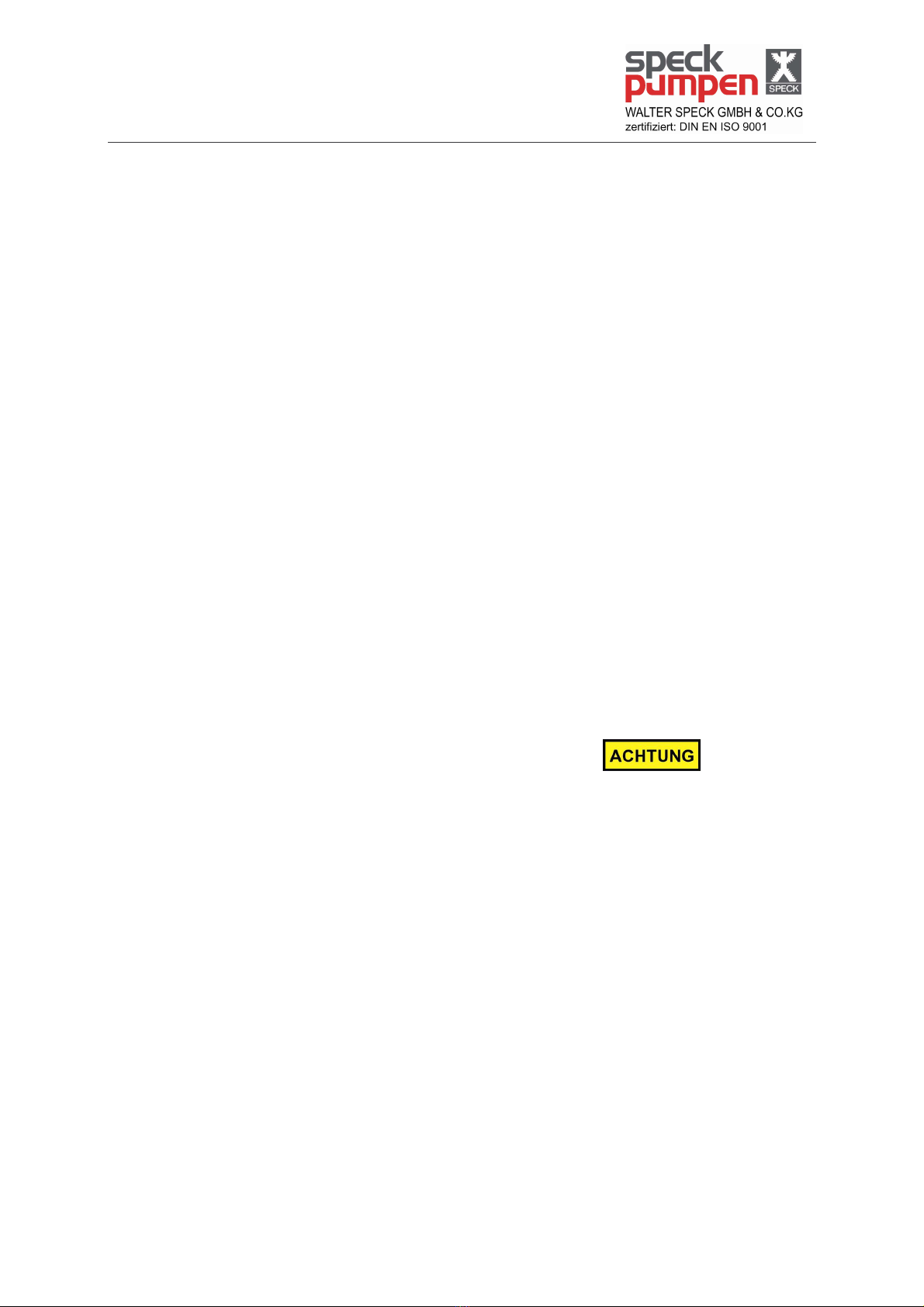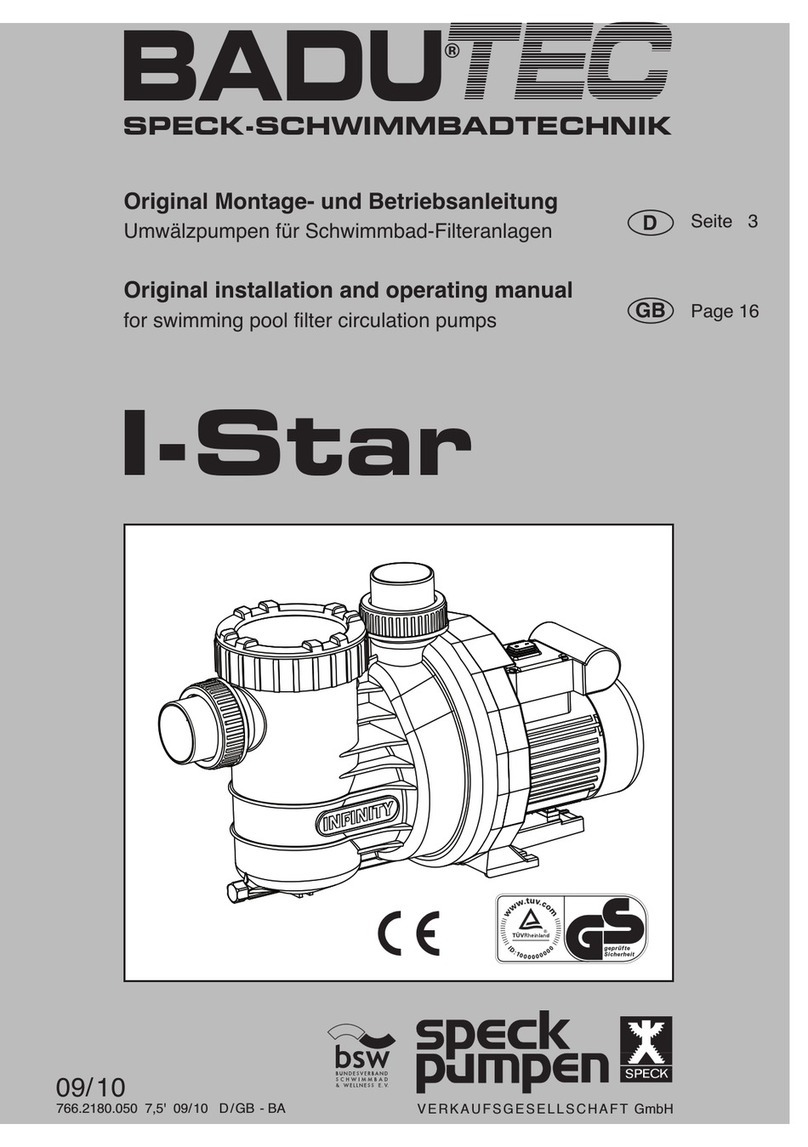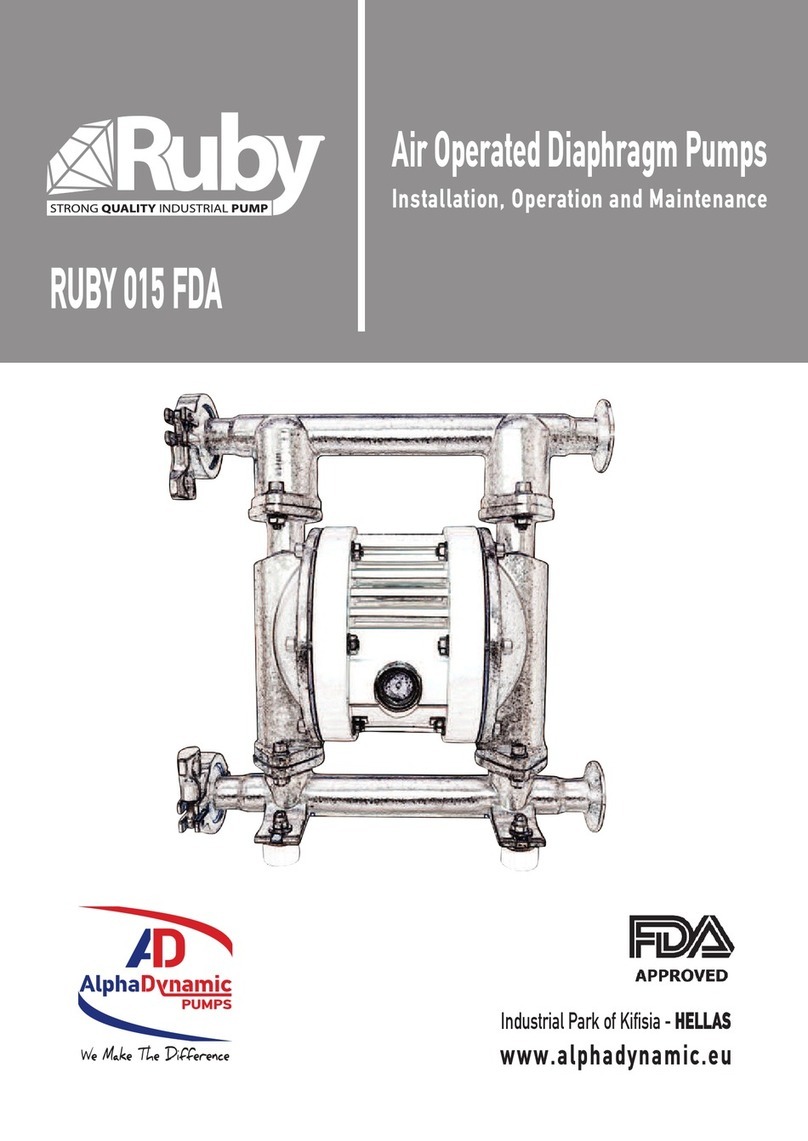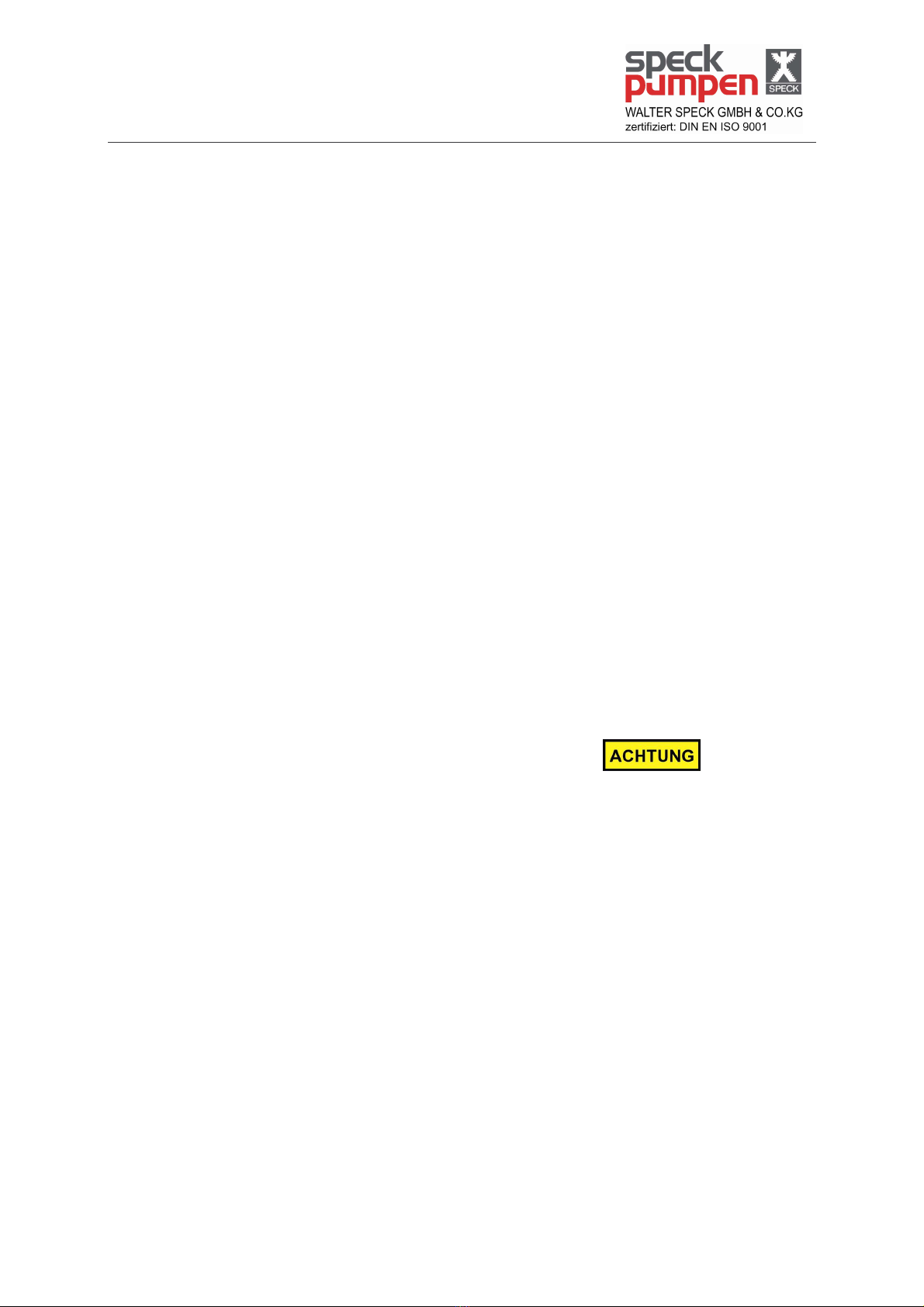
BETRIEBSANLEITUNG
11
7
Betrieb
7.1
Allgemeines
Bei Förderung von Luft und anderen inerten
Gasen wird normalerweise Wasser als
Ringflüssigkeit verwendet. Andere
Ringflüssigkeiten als Wasser können ebenso
verwendet werden. Die Ringflüssigkeit muss
frei von Feststoffen sein, da sonst Verschleiss
am Gehäuse auftreten kann. Bei
Verunreinigungen des Fördermediums ist ein
Filter vorzuschalten.
Die kinematische Viskosität soll bei Betriebs-
temperatur max. 4 mm2/s betragen; höhere
Viskositäten bedingen eine größere
Antriebsleistung. Der Dampfdruck der
Ringflüssigkeit sollte im Vakuumbetrieb bei
Arbeitstemperatur 16 mbar betragen; höhere
Dampfdrücke vermindern das in den
Leistungstabellen bzw. Kennlinien
angegebene Saugvermögen und das
Endvakuum. Bei Verwendung anderer
Ringflüssigkeiten als Wasser sollten die
Förderdaten der Pumpe von uns bestätigt
werden.
Beim Mitfördem von Flüssigkeiten (ca. das
2 fache der im Prospekt angegebenen
Umlaufflüssigkeitsmenge) kann die Zufuhr von
Frischflüssigkeit wesentlich gedrosselt werden.
Eine Kondensation von Dampf in der
Vakuumpumpe kann Kavitation verursachen
und dadurch Teile der Pumpe zerstören. Es ist
daher eine Kondensation vor der
Vakuumpumpe vorzuziehen (Einspritz-,
Oberflächenkondensator usw.). Das anfallende
Kondensat kann in einigen Fällen von der
Vakuumpumpe mitgefördert werden. Sonst ist
eine getrennte Flüssigkeitspumpe vorzusehen
Die Auslegung sollte durch den
Hersteller/Lieferanten erfolgen.
Das listenmäßige Saugvermögen (bzw. der
listenmäßige Volumenstrom) wird bei einer
Betriebswassertemperatur von 15°
C erreicht.
Ein Betrieb bei höheren
Betriebswassertemperaturen bedingt ein
vermindertes Saugvermögen (bzw. einen
verminderten Volumenstrom), ergibt aber
gleichzeitig die Möglichkeit zur Einsparung von
Frischwasser bzw. Kühl-flüssigkeit bei offener
bzw. geschlossener Umlaufkühlung. Diese
Flüssigkeitsmenge soll daher mit dem
Regulierventil rFbzw. rBnur so groß eingestellt
werden, dass das gewünschte Saugvermögen
(bzw. der gewünschte Volumenstrom) erreicht,
jedoch Kavitation verhindert wird. Das
Regulierventil ist in dieser Einstellung zu
blockieren.
Bei Vakuumbetrieb mit Ansaugdrücken unter
130 mbar sollte außerdem darauf geachtet
werden, dass eine Betriebswassertemperatur
von ca. 10°
C nicht unterschritten wird, da sonst
der Saugstutzen vereisen kann.
7.2
Frischwasserbedarf
Bei Durchlaufkühlung wird eine
Frischwassermenge gemäß Diagramm 1
benötigt.
Der Frischwasserbedarf bei offener
Umlaufkühlung wird nach Diagramm 1a und 1b
ermittelt. Dazu muss die Temperaturdifferenz
∆t (Temperatur des Betriebswassers minus
Temperatur des Frischwassers) festgelegt
werden. Bei zu hoher
Betriebswassertemperatur und
entsprechendem Vakuum ist mit Kavitation zu
rechnen.
Bei geschlossener Umlaufkühlung entspricht
der Umlaufflüssigkeitsstrom dem
Frischflüssigkeitsstrom bei Durchlaufkühlung.
Der Flüssigkeitsstand ist am
Flüssigkeitsanzeiger von Zeit zu Zeit zu
überprüfen und ggf. zu regulieren. Der Pegel
der Betriebsflüssigkeit darf bei stillstehender
Vakuumpumpe die Wellenmitte nicht
überschreiten.
7.3
Kavitation: Ursache und
Vermeidung
Ist in der Saugleitung lsein Absperrorgan
(Schieber oder dergleichen) angeordnet, und
soll die Pumpe in Betrieb gehalten werden,
wenn diese Absperrvorrichtung geschlossen
ist, so tritt Kavitation auf. Bei längerem Betrieb
werden dadurch Pumpenteile zerstört.
Soll überwiegend Dampf gefördert werden, der
beim Verdichten kondensiert, entsteht in der
Pumpe ebenfalls Kavitation.
•Um Kavitation mit ihren Folgen zu
vermeiden, wird eine kleine Gasmenge,
die beim Verdichten nicht kondensieren
kann, saugseitig oder über den
Kavitationsschutzanschluss zugegeben.
•Dies kann erfolgen über:
•einen Belüftungshahn h,
•eine ca. 300 mm hochgezogene Leitung
mit Düse IG
•eine Verbindungsleitung (mit Düse) zum
Flüssigkeitsabscheider aerfolgen.
Der Einsatz eines Gasstrahlers verhindert
ebenfalls die Kavitation (siehe Abb. 5).